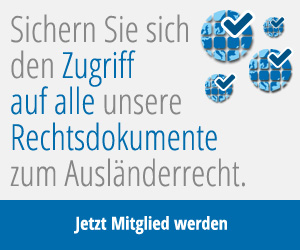§ 15 Abs. 5 (Kommentierung)
- Gesetz:
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
- Paragraph:
- § 15 Zurückweisung
- Autor:
- Stand:
- in: OK-MNet-AufenthG (10.06.2014)
X. § 15 Abs. 5: Zurückweisungshaft
39
40
=
Winkelmann, Neue Regelungen zum Haftrecht, Migrationsrecht.net.
Abs. 5 ist die allgemeine Regelung, während Abs. 6 eine Spezialregelung nur für Flughäfen mit Transitbereich enthält. Bisher wurde die Zurückweisungshaft als Annexregelung zu § 62 (Abschiebungshaft) in analoger Anwendung verstanden. Problematisch erschien bisher in diesem Zusammenhang die mangelnde Bestimmtheit der Norm, da § 62 auf die Abschiebungshaft zugeschnitten war und ist. Wesentliche Normen, die in das Rechtsgut Freiheit der Person eingreifen, sollten eigenständig und klar verständlich geregelt werden, mithin inhaltlich deutlich hinreichender bestimmt sein. Dieser Forderung ist der Gesetzgeber mit Abs. 5 grundsätzlich nachgekommen. Auch bisher war die Beantragung von Haft zur Vorbereitung der Zurückweisung nach § 62 Abs. 1-alt als nachrangig zu betrachten gewesen, da wie § 15 Abs. 5 ebenfalls vorsieht, grundsätzlich von einer bereits ergangenen Zurückweisungsentscheidung ausgegangen werden musste. Allerdings war die Zurückweisungshaft in der alten Fassung zur Vorbereitung einer Zurückweisungsentscheidung über § 62 Abs. 1-alt möglich. Das ist nun nicht mehr so (s.o. Rn. 1). Sofern eine Zurückweisung - unter entsprechender Berücksichtigung möglicher Zurückweisungshindernisse im Sinne des § 60 Abs. 1 bis 3, 5 und 7 bis 9 rechtmäßig ergangen ist, der begründete Verdacht besteht, dass die Person sich dem Vollzug der Zurückweisung entziehen will und die Haft zur Sicherung der Zurückweisung verhältnismäßig wäre, beantragt die Grenzbehörde nunmehr die Sicherungshaft gem. § 417 FamFG, in Eilfällen nach § 427 FamFG (s. dort) und in der Kurzkommentierung von
Winkelmann,
Das neue FamFG und dessen rechtliche Auswirkungen.
Soweit Marx in InfAuslR 11/12 2013, 413, 414 mit Bezug auf die Auswirkungen der Dublin III-VO (VO (EU) Nr. 604/2013 v. 26.06.2013, ABl.EU Nr. L 180 S. 31) davon ausgeht, bei der Beantragung der Zurückweisungshaft sei bislang unklar gewesen, ob auch Haftgründe nach § 62 Abs. 3 bezeichnet werden mussten und erst jetzt mit Art. 28 Dublin III-VO gefordert werden, wird dem nicht gefolgt. Siehe schon zum bisherigen Begründungserfordernis sogleich in Rn. 41ff.
Richtig ist hingegen, dass eine Nichtberücksichtigung der Haftgründe nach § 62 Abs. 3 jedenfalls mit Anwendung der Dublin III-VO seit 01.01.2014 mit Unionsrecht unvereinbar ist. Nicht der Nichtverweis in § 15 Abs. 5 auf die Dublin III-VO führt zur Europarechtswidrigkeit, sondern die mangelnde Anwendung im Lichte der europarechtlichen Vorgaben (so auch LG Dresden, B. v. 28.01.2014 – 2 T 44/14 –, das folgerichtig davon ausgeht, die Haft sei nunmehr in Art. 28 Dublin III-VO geregelt und verdränge qua Verordnungsrecht entgegenstehendes nationales Recht. So jedenfalls bei verbindlichen europäischen Regeln, wie sie mit Art. 28 Abs. 1 und 2 Dublin III-VO geschaffen worden sind. Nach Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO dürfen Personen nicht allein deswegen in Haft genommen werden, weil sie dem durch die VO festgelegten Verfahren unterliegen. Ausschließlich zum Zwecke des Überstellungsverfahren im Einklang mit der VO dürfen Personen ausnahmsweise und bei erheblicher Fluchtgefahr im Rahmen einer Einzelfallprüfung in Haft genommen werden. Dies auch nur dann, wenn die Inhaftnahme verhältnismäßig ist und sich weniger einschneidende Maßnahmen nicht wirksam anwenden lassen (Art. 28 Abs. 2 Dublin III-VO). Die Definition der Haftgründe, die Art. 2 Buchst. n Dublin III-VO verlangt, ist dem nationalen Recht zu entnehmen, nachdem eine gesetzliche Regelung auf europäischer Ebene nicht erfolgt oder beabsichtigt ist und die VO insofern auf nationales Recht verweist. Nachdem Art. 2 Buchst. n Dublin III-VO eine gesetzliche Regelung der Haftgründe verlangt, kann insofern auf § 62 Abs. 3 S. 1 Nr. 5 und die hierzu ergangene Rechtsprechung direkt zugegriffen werden. Art. 28 Abs. 4 Dublin III-VO verweist auf die haftrechtlichen Vorschriften der Art. 9-11 RL 2013/33/EU. In der Umsetzungsphase der RL in Bezug auf diese Vorschriften bis 20.07.2015 gilt dieser Verweis als Verweis auf die RL 2003/3/EG bzw. RL 2005/85/EG (vgl. Art. 49 Abs. 1, 3. UA Dublin III-VO). Letztere RL weist in Art. 18 keine besonderen Vorschriften auf. Schon wegen dieser dynamischen Verweisung auf inhaltlich nicht miteinander vergleichbarer Haftvorschriften ist eine Inhaftierung in dieser Übergangszeit nicht schon deshalb unzulässig, weil es an einer gesetzlichen Normierung im nationalen Recht fehlt. Um dem gesetzgeberischen Willen des Verordnungsgebers gleichwohl Geltung zu verschaffen, müssen die nationalen haftrechtlichen Beschlüsse bis zum 20.07.2015 im Lichte der RL 2013/33/EU bewertet werden.
Von der Bezeichnung der Haftart als "Überstellungshaft" (so Stahmann in ANA-ZAR 1/2014) zu folgern, diese sei derzeit im nationalen Recht gar nicht geregelt und insbesondere keine solche Haft nach § 14 Abs. 3 AsylVfG, mit der weiteren Folge, dass die Überstellungshaft zurzeit nicht zulässig sei, ist fehlgehend. Die Bezeichung in Art. 28 Abs. 1 Dublin III-VO spricht von Haft zwecks Sicherstellung von Überstellungsverfahren. Das ist auch die derzeitige Zurückweisungs- oder Zurückschiebungshaft (s. dazu unter § 57), soweit sie den zuvor genannten Voraussetzungen entspricht und europarechtskonform angewendet wird. Insoweit liegt hier auch kein Verstoß gegen das Zitiergebot vor. Einer konkretisierenden Klarstellung im nationalen Recht bedarf es natürlich dennoch.
41
Die Zurückweisungshaft ist an folgende Voraussetzungen (s. bei Winkelmann, ZAR 2007, 268 = E-Book, a.a.O. sowie
gebunden:
- Rechtmäßig ergangene Zurückweisungsentscheidung,
- Unmöglichkeit der der sofortigen Vollziehung der Zurückweisung,
- begründeter Verdacht, dass die Person unerlaubt einreisen will und
- kein Hinderungsgrund nach § 62 Abs. 3 Satz 4.
- Verhältnismäßigkeit
Nicht mehr persönlich vorwerfbares Verhalten, sondern allein das öffentliche Interesse an einem reibungslosen und jederzeit möglichen Vollzug administrativer Maßnahmen soll danach eine freiheitsentziehende Maßnahme stützen.
42
43
44
„Die Haft zur Sicherung der Zurückweisung bedarf stets einer richterlichen Anordnung und kann nicht von der Grenzbehörde auf eigene Faust angeordnet und/oder vollzogen werden. Die Vorgabe, dass der Betroffene in Haft genommen werden "soll", ist allein an den Richter gerichtet“.
Gegen einen zu extensiven Gebrauch der Zurückweisungshaft sprechen verfahrensrechtliche Hürden bei der Vorführung vor den Richter. § 15 Abs. 5 verweist nicht auf § 62 Abs. 4, so dass der Grenzbehörde diese Festnahmebefugnis nicht zur Verfügung steht, um den Ausländer dem Haftrichter vorführen zu können. Die Grenzbehörde kann auf der Grundlage einer polizeilichen Gewahrsamnahme nach § 39 Abs. 1 Nr. 3 BPolG eine Vorführung erreichen. Diese ist aber nur zulässig, wenn dies unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer Straftat zu verhindern. Außerdem muss die konkrete Gefahr bestehen, dass der Ausländer die Einreiseverweigerung nicht freiwillig befolgt. Da der Versuch einer unerlaubten Einreise nach § 95 Abs. 1 Nrn. 3, 2, 1 lit. a, Abs. 3 strafbar ist, ist eine polizeiliche Gewahrsamnahme grundsätzlich möglich. Voraussetzung ist aber die Verhinderung weiterer Straftaten und nicht nur der Zweck, den Ausländer dem Haftrichter vorführen zu wollen. Demgegenüber ist in Fällen des § 15 Abs. 2 und 3 keine polizeiliche Gewahrsamnahme möglich, da mangels unerlaubter Einreise keine Straftat des Ausländers konkret bevorsteht (so auch Westphal/Stoppa, a.a.O., S. 581).
45
46
![]() Zur nationalen Umsetzung der Rückführungsrichtlinie, S. 8
Zur nationalen Umsetzung der Rückführungsrichtlinie, S. 8
Die Zurückweisung wird außer Vollzug gesetzt (nach § 15 Abs. 5 S. 3 findet Absatz 1 keine Anwendung mehr, s.o.). Die ausländerrechtliche Einreise ist nach § 13 AufenthG daher vollendet (§ 13 Abs. 2 S. 2 kann nicht mehr begründet werden; zum bisherigen Recht vgl. in „Neue Regelungen zum Haftrecht“, Winkelmann, MNet, Nr. 2.3).
Zusätzlich zum Eintritt der gesetzlichen Ausreisepflicht ist eine Rückkehrentscheidung zu verfügen. Das Verfahren richtet sich nach der RüFü-RL.
47
Einreise und Aufenthalt sind entgegen der Nr. 15.5.4 AVwV solange nicht unerlaubt, wie der Betroffene der behördlichen Zurückweisungsentscheidung zu dem vorgesehenen Abflugtermin auch nachkommt. Die aufschiebende Wirkung der Zurückweisung besteht solange sie nicht vollzogen werden kann und sollte durch eine Verfügung der Grenzbehörde, die dem Betroffenen auszuhändigen ist, deutlich gemacht werden. In unabsehbar langen Fällen (eine Zurückweisung ist aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen zunächst gar nicht oder jedenfalls nicht innerhalb von 3 Monaten (Rechtsgedanke aus § 62 Abs. 4 Satz 4) möglich), ist Verbindung mit der zuständigen Ausländerbehörde aufzunehmen, um den faktischen Aufenthalt über eine Duldung (§ 60a Abs. 2 Satz 1, 4) rechtlich zu ermöglichen. Auch wenn die Einreise des Ausländers von der Grenzpolizei nicht verhindert werden kann, so macht dies die Einreise nicht rechtmäßig. Die Einreise ist vielmehr unerlaubt und eröffnet ggf. die Möglichkeit der Zurückschiebung nach § 57 Abs. 1 AufenthG.
48
49
Entwurf des 2. Richtlinienumsetzungsgesetzes Stand: September 2010
Dieses Vorhaben wurde im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens auf Anraten des Bundesjustizministeriums jedoch aufgegeben.
Die neue Regelung sieht vor, dass das Gericht für die Entscheidung zuständig ist, in dessen Bezirk sich der Betroffene zum Zeitpunkt der Entscheidung der Haft befindet, ohne dass es einer Abgabeentscheidung nach § 106 Abs. 2 Satz 2 bedürfte (s. dazu Hoppe, ZAR, 7/2009, S. 209 f.). Zunächst spricht nach dem gegenwärtigen Stand der Betrachtung nach diesseitiger Auffassung vieles dafür, dass die Beibehaltung des § 106 Abs. 2 Satz 2 AufenthG kein Redaktionsversehen des Gesetzgebers darstellt (so aber Hoppe, a.a.O.), denn dies lässt sich jedenfalls mit der Gesetzbegründung zum FamFG nicht vereinbaren. Der Gesetzgeber hat ausweislich der Gesetzesbegründung einen Änderungsbedarf nur im Hinblick auf § 106 Abs. 2 Satz 1 AufenthG gesehen. Nur insoweit hat der Gesetzgeber eine Folgeänderung wegen der Übernahme des Inhalts des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren bei Freiheitsentziehungen im Buch 7 des FamFG gesehen (vgl. BT-Drucks. 16/6308, S. 317 rechte Spalte; RA Peter Fahlbusch, Hannover in:
Winkelmann, Zur Zuständigkeit der Gerichte bei Abgabeentscheidungen
und vertiefend zum FamFG:
Winkelmann, FamFG, Nr. 8). sowie unter § 416 Rn. 8f.