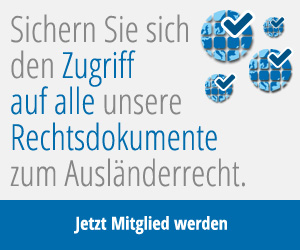Verwaltungsvorschrift zur Kommentierung
Gliederung
- Gesetz:
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
- Paragraph:
- § 25 Aufenthalt aus humanitären Gründen
- Kommentierung:
- Gliederung
- Autor:
- Wolfram Molitor
Verwaltungsvorschrift (Auszug)
Zu § 25 – Aufenthalt aus humanitären Gründen
25.1 Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigte
25.1.1
§ 25 Absatz 1 regelt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Asylberechtigte nach Artikel 16a GG. Voraussetzung für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis ist, dass der Ausländer – unanfechtbar als Asylberechtigter anerkannt worden ist (§ 25 Absatz 1 Satz 1) und – nicht aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist (§ 25 Absatz 1 Satz 2).
25.1.2
Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gebunden (§ 4 AsylVfG) und nicht berechtigt, im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis die Anerkennungsentscheidung des Bundesamtes auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen.
25.1.3
Vom Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 ist abzusehen (§ 5 Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe hierzu Nummer 5.4.2). Liegen die Voraussetzungen vor, hat der Ausländer einen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis; es verbleibt kein Entscheidungsermessen.
25.1.4
Nach Anerkennung als Asylberechtigter ist zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre zu erteilen (§ 26 Absatz 1 Satz 2). Erst danach kann, außer in den Fällen der Nummer 26.4.2, der Asylberechtigte eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Zu den Voraussetzungen der Niederlassungserlaubnis siehe Nummer 26.3. Es ist hingegen gesetzlich ausgeschlossen, dem Asylberechtigten eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt- EG zu erteilen (§ 9a Absatz 3 Nummer 1, siehe Nummer 9a.3.1.1).
25.1.5
Zur Verlängerung der nach § 25 Absatz 1 erteilten Aufenthaltserlaubnis siehe Nummer 25.2.4.
25.1.6
Nach § 25 Absatz 1 Satz 2 darf eine Aufenthaltserlaubnis im Falle einer Ausweisung aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht erteilt werden. In diesen Fällen ist über die Aussetzung der Abschiebung eine Bescheinigung nach § 60a Absatz 4 auszustellen. Hinsichtlich der Ausweisung aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung siehe Nummer 56.1.0.2 ff.
25.1.7
Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 tritt bis zur Entscheidung über die Aufenthaltserlaubnis die Erlaubnisfiktion ein. Der Aufenthalt gilt danach abweichend von der allgemeinen Fiktionsregelung des § 81 Absatz 3 Satz 1 nicht ab der Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis, sondern bereits für die Zeit zwischen der unanfechtbaren Anerkennung als Asylberechtigter nach Artikel 16a Absatz 1 GG und der Entscheidung über die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 Satz 1 als erlaubt.
25.1.8
Asylberechtigte sind ebenfalls die Ausländer, denen Familienasyl nach § 26 Absatz 1 und 2 AsylVfG gewährt worden ist.
25.1.9
Nach Absatz 1 Satz 4 gestattet die erteilte Aufenthaltserlaubnis uneingeschränkte Erwerbstätigkeit.
25. 1.10 Die Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 1 kann grundsätzlich nach den allgemeinen Vorschriften (vgl. § 12) mit einer Nebenbestimmung, insbesondere mit Bedingungen und Auflagen versehen werden, soweit sie mit der Rechtsstellung des Asylberechtigten vereinbar sind und nicht den garantierten Rechten des Asylberechtigten zuwiderlaufen. Zu Einschränkungen bei der Verfügung wohnsitzbeschränkender Auflagen an Inhaber von Aufenthaltstiteln nach § 25 Absatz 1 vgl. Nummer 12.2.5.2.3.
25. 1.11 Hinsichtlich des Widerrufs des Aufenthaltstitels eines Asylberechtigten siehe Nummer 52.1.4.
25.2 Aufenthaltserlaubnis für Konventionsflüchtlinge
25.2.1
§ 25 Absatz 2 regelt die Aufenthaltsgewährung für Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Voraussetzung für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 Satz 1 ist, dass – dem Ausländer nach § 3 Absatz 4 AsylVfG die Flüchtlingseigenschaft unanfechtbar zuerkannt wurde und – der Ausländer nicht aus schwerwiegenden Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewiesen worden ist (§ 25 Absatz 2 Satz 2 i.V.m. § 25 Absatz 1 Satz 2, siehe Nummer 25.1.1).
25.2.2
Die Ausländerbehörden sind an die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge gebunden (§ 4 AsylVfG) und nicht berechtigt, im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis die Anerkennungsentscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen. Von den Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und Absatz 2 ist abzusehen (§ 5 Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden.
25.2.3
Die in § 25 Absatz 1 Satz 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen über die Erlaubnisfiktion und die Berechtigung zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit gelten auch bei Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 2 (siehe Nummer 25.1.7 und 25.1.9). Ebenso wie bei anerkannten Asylberechtigten wird auch bei anerkannten Flüchtlingen die Aufenthaltserlaubnis auf drei Jahre befristet erteilt (§ 26 Absatz 1 Satz 2). Erst danach – außer in den Fällen der Nummer 26.4.2 – kann der Ausländer eine Niederlassungserlaubnis erhalten. Zu den Voraussetzungen siehe Nummer 26.3.
25.2.4
Nach Artikel 24 Absatz 1 der Richtlinie 2004/ 83/EG des Rates vom 29. April 2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (ABl. EU Nummer L 304 S. 12, so genannte Qualifikationsrichtlinie) sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, Personen, denen die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden ist, einen Aufenthaltstitel auszustellen, der mindestens drei Jahre gültig und verlängerbar sein muss. Nach richtlinienkonformer Auslegung des § 26 Absatz 1 Satz 1 und 2 muss daher ein nach § 25 Absatz 2 erteilter Aufenthaltstitel verlängerbar sein. Dabei gilt die Gültigkeitsdauer von drei Jahren nach § 26 Absatz 1 Satz 2 jedoch entsprechend dem ausdrücklichen Wortlaut nur für die Ersterteilung. Die Verlängerung richtet sich nach § 26 Absatz 1 Satz 1 und kann für eine kürzere Geltungsdauer erfolgen. Eine Fiktionsbescheinigung nach § 81 Absatz 4 anstelle der Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur in Betracht, wenn die Mitteilung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nach § 73 Absatz 2a AsylVfG unmittelbar bevorsteht.
25.2.5
Es ist gesetzlich ausgeschlossen, anerkannten Flüchtlingen eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG zu erteilen (§ 9a Absatz 3 Nummer 1, siehe Nummer 9a.3.1.1).
25.2.6
Anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt sind Ausländer, denen Familienflüchtlingsschutz nach § 26 Absatz 4 AsylVfG gewährt worden ist. Volljährige ledige Kinder eines Ausländers, der vor Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes als Flüchtling anerkannt wurde, und die zum Zeitpunkt der Asylantragstellung minderjährig waren, können keinen Familienflüchtlingsschutz nach § 26 Absatz 4 AsylVfG erhalten. Für sie sieht die Übergangsregelung in § 104 Absatz 4 eine entsprechende Anwendung von § 25 Absatz 2 vor (siehe Nummer 104.4).
25.2.7 Hinsichtlich des Widerrufs des Aufenthaltstitels eines anerkannten Flüchtlings siehe Nummer 52.1.4.
25.3 Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2 bis 7
25.3.1
Nach § 25 Absatz 3 soll einem Ausländer eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 vorliegt. Die Regelung dient auch der Umsetzung der Qualifikationsrichtlinie. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 setzt voraus, dass
- ein Abschiebungsverbot nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 vorliegt und
- keine schwerwiegenden Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer eine der Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) verwirklicht. Für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis bei Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 ist ferner erforderlich, dass nach § 25 Absatz 3 Satz 2
- die Ausreise in einen anderen Staat nicht möglich und nicht zumutbar ist (vgl. Nummer 25.3.5) und
- kein wiederholter oder gröblicher Verstoß gegen entsprechende Mitwirkungspflichten vorliegt. In den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 wird eine Aufenthaltserlaubnis auch dann erteilt, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist oder aber wiederholt oder gröblich gegen Mitwirkungspflichten verstoßen wurde. Mit § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 wird der subsidiäre Schutz nach Artikel 15 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht übertragen. Da die Richtlinie nur die Ausschlussklauseln nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) vorsieht, ist – bei richtlinienkonformer Auslegung – eine Ausdehnung auf die weiteren in § 25 Absatz 3 Satz 2 genannten Ausschlussgründe nicht möglich.
25.3.2
Vom Vorliegen der allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 Absatz 1 und 2 ist abzusehen (§ 5 Absatz 3 Satz 1); von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe hierzu Nummer 5.4.2). Zwar ist nach § 5 Absatz 3 Satz 1 auch von der Erfüllung der Passpflicht abzusehen; wirkt der Ausländer jedoch an der Passbeschaffung nicht mit oder verstößt er gegen seine Pflichten bei der Feststellung und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger Reisepapiere, kann dies einen gröblichen Verstoß gegen Mitwirkungspflichten i. S. d. § 25 Absatz 3 Satz 2 darstellen (zu den Folgen siehe unten Nummer 25.3.6.1 f.); in Bezug auf den Verfolgerstaat ist der Ausländer nicht zu Mitwirkungshandlungen verpflichtet. Die Ablehnung des Asylantrags als offensichtlich unbegründet steht nach § 10 Absatz 3 Satz 3, 2. Halbsatz (siehe Nummer 10.3.3.2) der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 nicht entgegen. Liegen die Voraussetzungen für die Erteilung nach § 25 Absatz 3 vor, hat die Ausländerbehörde grundsätzlich keinen Ermessensspielraum. In den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2 gilt dieser Grundsatz – bei richtlinienkonformer Auslegung des § 25 Absatz 3 im Hinblick auf Artikel 24 Absatz 2 der Qualifikationsrichtlinie – ausnahmslos (soweit zwingende Gründe der öffentlichen Sicherheit und Ordnung i. S. v. Artikel 24 Absatz 2 der Qualifikationsrichtlinie vorliegen, steht allerdings ein auf solchen Gründen fußendes Einreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Absatz 1 der Titelerteilung entgegen, wobei in diesen Fällen in aller Regel bereits der Tatbestandsausschluss nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstaben a) bis d) greifen dürfte). In den Fällen des § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 steht in atypischen Fallgestaltungen die Erteilung im Ermessen (siehe Beispiele hierzu unter Nummer 25.3.3.3). In allen Fällen des § 60 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1 steht ein bestehendes Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 der Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegen.
25.3.3.1
Hat der Ausländer einen Asylantrag gestellt, entscheidet nach § 24 Absatz 2, § 31 Absatz 3 AsylVfG das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge über das Vorliegen von Abschiebungsverboten. An die Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist die Ausländerbehörde gebunden (§ 42 AsylVfG). Grundsätzlich setzt die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis die Unanfechtbarkeit der positiven Entscheidung voraus. Diese Voraussetzungen liegen für positive Entscheidungen des Bundesamtes, die nach dem 1. Januar 2005 erlassen wurden, immer vor, da sie unmittelbar in Bestandskraft erwachsen. Die Voraussetzungen liegen nicht vor bei positiven Entscheidungen, die vor dem 1. Januar 2005 erlassen wurden und noch rechtshängig sind. Hier kann erst nach rechtskräftiger positiver Entscheidung eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde unverzüglich über die getroffene Entscheidung sowie über Erkenntnisse, die der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis entgegenstehen können (§ 24 Absatz 3 AsylVfG).
25.3.3.2
Die Ausländerbehörde ist nur dann für die Feststellung von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder Absatz 7 zuständig, wenn der Ausländer keinen Asylantrag gestellt hat. In diesem Fall darf die Ausländerbehörde gemäß § 72 Absatz 2 nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes eine Entscheidung über das Vorliegen eines Abschiebungsverbotes treffen.
25.3.3.3
Für die Fälle des § 60 Absatz 5 und Absatz 7 Satz 1, in denen – anders als in den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 oder Absatz 7 Satz 2 – in atypischen Fällen die Aufenthaltserlaubnis versagt werden kann, gilt Folgendes: Hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in den Fällen des § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 Satz 1 ein Widerrufsverfahren eingeleitet, ändert dies nichts an der Bindungswirkung nach § 42 AsylVfG. Für einen Widerruf der Aufenthaltserlaubnis ist notwendig, dass der Widerruf des Abschiebungsverbots unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist (§ 52 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c); siehe Nummer 52.1.5.1.3). Die Erteilung bzw. Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis steht dann jedoch im Ermessen der Ausländerbehörde, da die Einleitung eines Widerrufsverfahrens durch das Bundesamt wegen einer Änderung der Verhältnisse im Zielstaat der Abschiebung einen atypischen Ausnahmefall begründet. Das gleiche gilt, wenn offenkundig ist, dass die Gefährdungslage im Heimatstaat nicht mehr besteht oder aus anderen Gründen mit dem Widerruf der anerkennenden Entscheidung des Bundesamtes zu rechnen ist. Die Ausländerbehörde hat in diesem Fall bei der Entscheidung über die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und nach Würdigung des in Frage stehenden Widerrufsgrundes eine Prognose darüber zu treffen, ob und wann ein Widerruf des Abschiebungsverbots zu erwarten ist. Je weniger absehbar eine Beendigung des Aufenthalts erscheint, desto näher liegt es, das Ermessen dahin gehend auszuüben, eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen. Hinsichtlich der voraussichtlichen Dauer des Verfahrens kann das Bundesamt beteiligt werden. Die Ausländerbehörden haben bei der Prüfung von Sicherheitsbedenken die Möglichkeit, nach § 73 Absatz 2 die dort genannten Sicherheitsbehörden zu beteiligen.
25.3.4
Die Aufenthaltserlaubnis ist für mindestens ein Jahr zu erteilen (§ 26 Absatz 1 Satz 2). Sie kann mit Auflagen und Bedingungen verbunden (§ 12 Absatz 2) und ggf. nachträglich zeitlich verkürzt werden (§ 7 Absatz 2 Satz 2).
25.3.5.1
§ 25 Absatz 3 Satz 2 stellt sicher, dass kein Aufenthaltstitel erteilt wird, wenn die Ausreise in einen anderen Staat möglich und zumutbar ist. In diesen Fällen bleibt es bei der Duldung nach § 60a, es wird eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (§ 60a Absatz 4) erteilt. Der Ausschlussgrund ist jedoch nicht anwendbar in den Fällen des § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2. Die Bestimmungen beruhen auf der Qualifikationsrichtlinie, nach der die Möglichkeit der Ausreise in einen Drittstaat keinen Grund für die Versagung der Aufenthaltserlaubnis darstellt.
25.3.5.2
Der Begriff der Ausreise umfasst sowohl die zwangsweise Rückführung als auch die freiwillige Ausreise. Es ist daher unerheblich, ob eine zwangsweise Rückführung unmöglich ist, z. B. weil eine Begleitung durch Sicherheitsbeamte nicht durchgeführt werden kann, wenn der Ausländer freiwillig in den Herkunftsstaat oder in einen anderen aufnahmebereiten Staat ausreisen könnte. Dabei ist nicht auf das bloße Verlassen des Bundesgebiets abzustellen, sondern auch darauf, ob es dem Ausländer möglich ist, in einen anderen Staat einzureisen und sich dort aufzuhalten.
25.3.5.3
Ein anderer Staat ist ein Drittstaat, in dem der betroffenen Person die in § 60 Absatz 5 oder Absatz 7 Satz 1 genannten Gefahren nicht drohen.
25.3.5.4
Möglich ist die Ausreise, wenn die betroffene Person in den Drittstaat einreisen und sich dort zumindest für die Zeit ihrer Schutzbedürftigkeit aufhalten darf. Eine kurzfristige Möglichkeit zum Aufenthalt in einem anderen Staat genügt hierfür nicht. Die Ausreise ist zumutbar, wenn die mit dem Aufenthalt im Drittstaat verbundenen Folgen die betroffene Person nicht stärker treffen als die Bevölkerung des Drittstaates oder die Bevölkerungsgruppe, der der Betroffene angehört. Dies ist z. B. bei gemischt nationalen Ehen der Fall, wenn dem Ehepartner die Einreise und der Aufenthalt im Heimatstaat des anderen Ehepartners erlaubt wird oder wenn der betroffenen Person aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit Einreise und Aufenthalt in einem Drittstaat gestattet wird.
25.3.5.5
Die Darlegung, in welchen Staat eine Ausreise möglich ist, obliegt der Ausländerbehörde. Sie hat sich dabei an konkreten Anhaltspunkten zu orientieren. Maßgeblich für die Auswahl ist die Beziehung der betroffenen Person zum Drittstaat (Beispiele: Ausländer hat einen Aufenthaltstitel für einen Drittstaat oder hat lange dort gelebt; Ehepartner oder nahe Verwandte sind Drittstaatsangehörige; Ausländer gehört einer Volksgruppe an, der im Drittstaat regelmäßig Einreise und Aufenthalt ermöglicht wird) und die Aufnahmebereitschaft des Drittstaates. Der Ausländer kann hiergegen Einwendungen geltend machen.
25.3.5.6
Die Zumutbarkeit der Ausreise wird vermutet, sofern der Ausländerbehörde keine gegenteiligen Hinweise vorliegen. Unzumutbar ist die Ausreise in den Drittstaat insbesondere dann, wenn dem Ausländer dort die „Kettenabschiebung" in den Verfolgerstaat droht oder ihn dort ähnlich unzumutbare Lebensbedingungen erwarten. Demnach ist die Ausreise in einen Staat unzumutbar, wenn der Ausländer dort keine Lebensgrundlage nach Maßgabe der dort bestehenden Verhältnisse finden kann.
25.3.6.1
Eine Aufenthaltserlaubnis darf auch nicht erteilt werden, wenn der Ausländer wiederholt oder gröblich gegen „entsprechende Mitwirkungspflichten" (zu dem Begriff sogleich) verstößt. Auch dieser Ausschlussgrund ist nicht anwendbar bei Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3 und 7 Satz 2, da es sich hierbei um subsidiäre Schutztatbestände nach der Qualifikationsrichtlinie handelt, die derartige Ausschlussgründe nicht vorsieht. Stellt das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Abschiebungsverbot in diesem Sinne fest, enthält der Bescheid einen entsprechenden Hinweis. Die Vorschrift sanktioniert nicht die wiederholte oder gröbliche Verletzung aller, sondern nur „entsprechender" Mitwirkungspflichten (vgl. Nummer 25.3.2). Der Ausländer muss hierzu eine gesetzliche Mitwirkungspflicht nach dem Aufenthaltsgesetz oder dem AsylVfG verletzt haben, wodurch die Ausreise in einen anderen Staat gegenwärtig nicht möglich oder zumutbar ist. Hierzu zählen insbesondere die ausweisrechtlichen Mitwirkungspflichten sowie die Pflichten bei der Feststellung und Sicherung der Identität und der Beschaffung gültiger Reisepapiere (§§ 48, 49, 82 Absatz 4, §§ 15, 16 AsylVfG). Ein Bezug auf einen konkreten Zielstaat muss nicht vorliegen. Auch wenn nach § 5 Absatz 3 Satz 1 bei Vorliegen der besonderen Erteilungsvoraussetzungen auf das Vorliegen von § 5 Absatz 1 Nummer 1a und Nummer 4 verzichtet wird, bedeutet dies nicht, dass den Ausländer keine Mitwirkungspflichten bei der Identitätsfeststellung und der Beschaffung von Reisedokumenten treffen. Ein Verstoß gegen andere gesetzliche Mitwirkungspflichten, die sich nicht auf das Ausländerrecht beziehen (z. B. AsylbLG oder SGB II), genügt dagegen nicht.
25.3.6.2
Der einfache Verstoß gegen die unter Nummer 25.3.6.1 genannten Mitwirkungspflichten reicht nicht aus. Erforderlich ist, dass der Ausländer mehr als einmal gegen entsprechende Mitwirkungspflichten verstoßen hat, wobei der Verstoß gegen unterschiedliche Mitwirkungspflichten genügt. Ein wiederholter Verstoß setzt allerdings voraus, dass der Ausländer in unterschiedlichen Situationen und nicht im Rahmen eines einheitlichen Lebenssachverhalts gegen die Mitwirkungspflichten verstößt. Eine einmalige Verletzung der Mitwirkungspflichten ist jedoch dann ausreichend, wenn es sich um einen gröblichen Verstoß handelt. Ein gröblicher Verstoß gegen eine Mitwirkungspflicht liegt dann vor, wenn der Ausländer durch aktives Tun hiergegen verstößt. Die Begehung strafbarer Handlungen, wie z. B. die Vorlage gefälschter Unterlagen, im Zusammenhang mit der Erfüllung von Mitwirkungspflichten begründet in jedem Fall einen gröblichen Verstoß. Die Formulierung „verstößt" bedeutet nicht, dass der Verstoß erst noch stattfinden muss oder unmittelbar bevorsteht; es genügt, dass ein bereits eingetretener Verstoß Auswirkungen auf die Gegenwart hat und nicht gänzlich ohne Wirkung geblieben ist.
25.3.7 Versagung der Aufenthaltserlaubnis bei Schutzunwürdigkeit und gegenüber Gefährdern
25.3.7.1
Eine Aufenthaltserlaubnis darf nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) nicht erteilt werden, wenn schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass der Ausländer schwere Menschenrechtsverletzungen oder andere Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen hat oder er eine Gefahr für die Allgemeinheit oder die Sicherheit des Landes darstellt. Die Vorschrift setzt Artikel 17 Absatz 1 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht um. Die Ausschlusstatbestände kommen – bei Vorliegen der Voraussetzungen – in allen Fällen der Aufenthaltserteilung aufgrund von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 in Betracht. Die vorliegenden Ausschlussgründe sind den Ausschlussklauseln im Flüchtlingsrecht (vgl. § 3 Absatz 2 AsylVfG, § 60 Absatz 8) ähnlich, aber weiter gefasst als diese. Mit der Vorschrift soll verhindert werden, dass schwere Straftäter und Gefährder, deren Aufenthalt nicht beendet werden kann, einen rechtmäßigen Aufenthalt in Deutschland erhalten.
25.3.7.2
Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist der Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis zwingend.
25.3.7.3
Es ist unerheblich, wo die Taten und Handlungen nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) begangen wurden. Zum Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis führt eine Tatbegehung im Herkunftsland, in einem Drittstaat oder in Deutschland.
25.3.7.4
Für die Anwendung der Ausschlussklauseln ist eine strafrechtliche Verurteilung des Ausländers nicht erforderlich. Umgekehrt schließt die Verbüßung einer Strafe die Anwendung der Ausschlussklauseln nicht aus.
25.3.7.5
Die Ausschlusstatbestände nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) kommen nicht nur in Betracht, wenn die Tat eigenhändig begangen wurde, sondern auch dann, wenn ein Ausländer einen anderen zu einer schweren Straftat anstiftet oder diesen dabei in irgendeiner Weise fördert oder unterstützt. Der Tatbeitrag kann z. B. in Hilfeleistungen bei der Durchführung der Tat, in verbaler Ermutigung oder öffentlicher Befürwortung der Tat bestehen. Für die Beurteilung, ob ein Ausschlusstatbestand vorliegt, muss die konkrete Tat und der Tatbeitrag des Ausländers benannt werden können. Die bloße Mitgliedschaft in einer Organisation, die für Straftaten verantwortlich ist, reicht i. d. R. noch nicht für einen Ausschluss aus. Besteht allerdings ein erheblicher Teil der Aktivitäten der Organisation in der Begehung von schweren Straftaten, steht die Mitgliedschaft einer aktiven Beteiligung an den Taten i. d. R. gleich. In diesen Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis zu versagen, sofern der Ausländer Kenntnis von den Aktivitäten hat und der Organisation freiwillig angehört.
25.3.7.6
Für die Anwendung der Ausschlussklauseln ist nur in den Fällen von § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe d) erforderlich, dass der Ausländer eine Gefahr für die Sicherheit Deutschlands oder für die Allgemeinheit darstellt. In den anderen Tatbestandsvarianten (Buchstabe a) bis c)) kommt es hierauf nicht an. Hier ist die Schutzunwürdigkeit des Betroffenen maßgeblich für die Versagung der Aufenthaltserlaubnis.
25.3.7.7
Es müssen schwerwiegende Gründe die Annahme rechtfertigen, dass Ausschlusstaten begangen wurden. Dafür sind mehr als bloße Verdachtsmomente erforderlich. Andererseits sind die Beweisanforderungen geringer als die für eine strafrechtliche Verurteilung geltenden Maßstäbe. Zum Nachweis können u. a. Aussagen des Antragstellers in seiner Anhörung vor der Ausländerbehörde oder dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Zeugenaussagen, Urkunden, Auskünfte des Auswärtigen Amtes oder anderer Stellen, aber auch Zeitungsartikel, Urteile oder Anklageschriften herangezogen werden.
25.3.7.8
Die Ausländerbehörde darf eine Entscheidung über das Vorliegen von Ausschlussgründen nur nach vorheriger Beteiligung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge treffen (vgl. § 72 Absatz 2). Damit wird das Einfließen der besonderen Sach- und Rechtskunde des Bundesamtes in diesen Bereichen sichergestellt. Es handelt sich jeweils um nicht selbständig anfechtbare verwaltungsinterne Stellungnahmen.
25.3.7.9
Aufgrund der Wortgleichheit der Vorschriften können Sachverhalte, die Ausschlussgründe nach § 3 Absatz 2 AsylVfG begründen oder nach § 60 Absatz 8 zur Versagung der Flüchtlingsanerkennung oder der Asylberechtigung geführt haben (vgl. § 30 Absatz 4 AsylVfG), auch im Hinblick auf eine Versagung gemäß § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis c) bzw. d) von Relevanz sein. Das Bundesamt unterrichtet die Ausländerbehörde über die im Asylverfahren zu Tage getretenen Ausschlussgründe (§ 24 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b) AsylVfG).
25.3. 7.10
Wird die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach dieser Vorschrift ausgeschlossen, erhält der Ausländer nach § 60a Absatz 2 und 4 eine Bescheinigung über die Aussetzung der Abschiebung.
25.3. 7.11
Der Ausschluss der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) schließt die Erteilung oder Beibehaltung einer Aufenthaltserlaubnis aus anderen Gründen nicht aus (z. B. wenn die Voraussetzungen für den Familiennachzug vorliegen); allerdings dürften in diesen Fällen regelmäßig die Erteilungsvoraussetzung nach § 5 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 nicht erfüllt sein oder ein Versagungsgrund nach § 5 Absatz 4 vorliegen. Bei abgelehnten Asylbewerbern ist allerdings zu beachten, dass Ausländern, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, gemäß § 10 Absatz 3 vor ihrer Ausreise eine Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden darf, wenn ein Anspruch besteht. Die Ausnahmeregelung in § 10 Absatz 3, 2. Halbsatz greift nicht, wenn ein Ausschlussgrund nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) vorliegt.
25.3.8
Die einzelnen Ausschlussgründe § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis d) überträgt die Ausschlussklauseln nach Artikel 17 der Qualifikationsrichtlinie in das deutsche Recht. Zwischen den einzelnen Tatbeständen der Vorschrift sind Überschneidungen möglich, so dass mehr als nur eine Tatbestandsalternative zur Anwendung kommen kann.
25.3.8.1 Ausschlussgründe in Anlehnung an das humanitäre Völkerrecht
25.3.8.1.0
Die Ausschlussgründe des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) sind dem humanitären Völkerrecht entlehnt. Die Auslegung der Tatbestände bestimmt sich daher vorrangig nach Maßgabe völkerrechtlicher Bestimmungen und nicht nach nationalen (strafrechtlichen) Vorschriften. Bislang gibt es keine allgemein gültige Definition der Begriffe „Verbrechen gegen den Frieden", „Kriegsverbrechen" und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Wesentliche Orientierungshilfe bei der Auslegung bietet aber das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs vom 17. Juli 1998 (BGBl. 2000 II S. 1393) sowie das VStGB, welches die Regelungen des Römischen Statuts in das deutsche Recht überträgt. Das Römische Statut enthält eine aktuelle und umfassende Kodifizierung von Straftaten, die nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) zur Versagung der Aufenthaltserlaubnis führen (vgl. §§ 7 ff. VStGB sowie Artikel 7 und 8 des Römischen Statuts). Auch hinsichtlich der weiteren allgemeinen Tatbestandselemente, wie etwa Tatbeteiligungsfragen, sind die beiden Regelungswerke heranzuziehen (vgl. etwa §§ 3, 4 VStGB, Artikel 25, 27, 28 des Römischen Statuts). Darüber hinaus sollten die weiteren geschriebenen wie ungeschriebenen Regeln des humanitären Völkerrechts herangezogen werden.
25.3.8.1.1 Verbrechen gegen den Frieden
Die Tatbestandsalternative „Verbrechen gegen den Frieden" umfasst Angriffskriege (bewaffnete Angriffe) und vergleichbare Aggressionen. Im Völkerrecht gibt es bisher keine allgemein anerkannte Definition für den Begriff Angriffskrieg. Der Begriff wird bislang weder im Römischen Statut noch im VStGB näher erläutert. Soweit diese Tatbestandsalternative in Betracht gezogen wird, kann auf die in der Entschließung 3314 der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom 14. Dezember 1974 enthaltenen Hinweise zurückgegriffen werden. Danach ist eine Angriffshandlung im obigen Sinne die Anwendung von Waffengewalt durch einen Staat gegen die Souveränität, die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines anderen Staates. Als Angriffshandlungen kommen in Betracht: Invasion oder Angriff durch die Streitkräfte eines Staates, militärische Besetzung, Beschießung oder Bombardierung, Blockade der Häfen und Küsten, Entsendung bewaffneter Banden, Gruppen, Freischärler oder Söldner und die wesentliche Beteiligung an solchen Aktionen. Grundsätzlich müssen die Angriffe aber nachhaltig sein und einen gewissen Schweregrad erreicht haben, um die Voraussetzungen für einen Angriffskrieg zu erfüllen. Da sich Verbrechen gegen den Frieden gegen die territoriale Integrität eines Staates richten, kommen grundsätzlich nur führende Vertreter von Staaten oder mit vergleichbarer Macht ausgestattete Personen als Täter in Betracht (z. B. Rebellenführer, die eine Sezession vom Staatsgebiet anstreben).
25.3.8.1.2 Kriegsverbrechen
Kriegsverbrechen sind schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht im Rahmen bewaffneter internationaler und nicht-internationaler Konflikte. Dazu zählen Verstöße gegen Regelungen zum Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an bewaffneten Kämpfen teilnehmen sowie Verstöße gegen Regelungen über die Mittel und Methoden der Kriegsführung (z. B. Einsatz verbotener Waffen). Kriegsverbrechen können von Zivilpersonen und Soldaten begangen werden. Umgekehrt können Zivilpersonen und Soldaten Opfer von Kriegsverbrechen werden.
25.3.8.1.2.1
Kriegsverbrechen setzen immer einen internationalen oder nicht-internationalen bewaffneten Konflikt voraus. Mit dem Begriff internationaler Konflikt wird eine bewaffnete Auseinandersetzung zwischen zwei oder mehreren Staaten bezeichnet. Auch die Besetzung eines Staates durch einen anderen Staat fällt darunter. Eine förmliche Kriegserklärung ist nicht erforderlich. Unter einem nicht-internationalen Konflikt ist eine bewaffnete Auseinandersetzung zu verstehen, an der die Regierung und bewaffnete Gruppen beteiligt sind oder bewaffnete Gruppen gegeneinander kämpfen. Im Falle nicht-internationaler bewaffneter Konflikte müssen die Auseinandersetzungen eine gewisse Größenordnung erreicht haben. Bürgerkriege können darunter fallen, nicht jedoch gelegentliche bewaffnete Kämpfe, allgemeine Spannungen, kleinere Grenzverletzungen und Unruhen (vgl. Zusatzprotokoll II vom 8. Juni 1977 zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer nicht-internationaler bewaffneter Konflikte). Der nicht-internationale Konflikt muss seiner Art und Intensität nach mit zwischenstaatlichen kriegerischen Auseinandersetzungen zumindest annähernd vergleichbar sein. Die Auseinandersetzungen müssen sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstrecken. Es reicht aus, wenn nur in einem Teil davon Kampfhandlungen stattfinden. Die Auseinandersetzungen müssen auch nicht notwendigerweise auf das Gebiet eines Staates beschränkt sein. Die bewaffneten Gruppen müssen einen bestimmten Organisationsgrad aufweisen, der innerhalb der Gruppe eine Befehlsstruktur ähnlich wie in regulären Streitkräften erlaubt (vgl. Artikel 1 des Zusatzprotokolls II vom 8. Juni 1977). Bewaffnete Banden, die nur einen losen Zusammenhang haben, fallen nicht darunter. Ein Hinweis darauf, dass es sich um einen nicht-internationalen bewaffneten Konflikt im völkerrechtlichen Sinne handelt, kann sich daraus ergeben, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder das Internationale Komitee des Roten Kreuzes mit dem Konflikt befasst.
25.3.8.1.2.2
Artikel 8 des Römischen Statuts (vgl. auch § 8 VStGB) enthält eine nicht abschließende Liste der Handlungen, die als Kriegsverbrechen in Betracht kommen. Dazu zählen u. a.:
- vorsätzliche Tötung einer nach dem humanitären Völkerrecht zu schützenden Person, z. B. Angehörige der Zivilbevölkerung,
- Angriffe auf Personen, die nicht mehr an den Feindseligkeiten teilnehmen, z. B. Verwundete, Kriegsgefangene,
- Zwangsumsiedlung geschützter Personen aus den besetzten Gebieten in das Territorium der Besatzungsmacht,
- Plünderungen,
- umfangreiche Zerstörungen und Aneignungen von zivilen Objekten, ohne dass hierfür eine militärische Notwendigkeit gegeben ist,
- Zwangsrekrutierung von unter 15-jährigen Kindern in die Streitkräfte,
- Anordnung, kein Pardon zu geben, Anwendung verbotener Mittel der Kriegsführung, z. B. biologischer und chemischer Waffen.
25.3.8.1.2.3
Für die Beurteilung, ob eine Handlung ein Kriegsverbrechen im Rahmen eines internationalen Konflikts darstellt, sind neben dem Römischen Statut die Rechtsinstrumente des Kriegsvölkerrechts zu beachten, insbesondere die Genfer Konventionen vom 12. August 1949 (BGBl. 1954 II S. 781, 783, 813, 838, 917; 1956 II S. 1586) und das Zusatzprotokoll I vom 8. Juni 1977 (BGBl. 1990 II S. 1550, 1637). Während für die unter Artikel 8 des Römischen Statuts fallenden Taten feststeht, dass es sich jeweils um Kriegsverbrechen handelt, kann dies für Verstöße gegen die in den Genfer Konventionen und anderen Vertragswerken genannte Verstöße nicht ohne weiteres angenommen werden. Da nicht alle, sondern nur schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht Kriegsverbrechen sind, muss im Einzelfall geprüft werden, ob der jeweilige Verstoß hinreichend schwerwiegend ist. Ein schwerer Verstoß in diesem Sinne ist anhand der Gesamtumstände des Einzelfalls zu beurteilen. Er liegt dann vor, wenn grundlegende Prinzipien der Menschlichkeit missachtet wurden (vgl. gemeinsamer Artikel 3 der Genfer Konventionen).
25.3.8.1.2.4
Für Taten, die im Rahmen von nicht-internationalen bewaffneten Konflikten verübt werden, findet das Römische Statut ebenfalls Anwendung. Allerdings kann hier nur eingeschränkt auf geschriebenes Völkerrecht zurückgegriffen werden. Eine unmittelbare Anwendung der Genfer Konventionen ist nicht möglich, da die darin enthaltenen Regelungen grundsätzlich nur für internationale Konflikte gelten. Grundlegend für die Beurteilung von Taten im Zusammenhang mit nicht-internationalen bewaffneten Konflikten sind der gemeinsame Artikel 3 der Genfer Konventionen, das Zusatzprotokoll II vom 8. Juni 1977 und das (übrige) Völkergewohnheitsrecht. Große Teile der Genfer Konventionen gehören inzwischen zum Völkergewohnheitsrecht und sind daher auch im Rahmen bewaffneter Konflikte anzuwenden.
25.3.8.1.3 Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schwere Menschenrechtsverletzungen, die im Rahmen ausgedehnter oder systematischer Angriffe gegen die Zivilbevölkerung verübt werden (vgl. Artikel 7 des Römischen Statuts, § 7 VStGB). Von isolierten Taten unterscheiden sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit dadurch, dass sie Teil eines bestimmten Verhaltensmusters sind, das i. d. R. auf einer ablehnenden Haltung gegenüber bestimmten nationalen, ethnischen, religiösen oder anderweitig charakterisierten Gruppen beruht. Es ist nicht erforderlich, dass mehrere Personen von dem Angriff betroffen sind. Vielmehr genügt auch eine gegen einen Einzelnen gerichtete Tat, wenn diese im Zusammenhang mit dem diskriminierenden Verhaltensmuster steht. Verbrechen gegen die Menschlichkeit können sowohl im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten als auch in Friedenszeiten begangen werden. Im Rahmen von bewaffneten Konflikten begangene Taten sollten jedoch unter dem spezielleren Tatbestandsmerkmal „Kriegsverbrechen" geprüft werden.
25.3.8.1.3.1
Eine nicht abschließende Liste der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist in Artikel 7 des Römischen Statuts (vgl. § 7 VStGB) enthalten. Dazu zählen u. a. folgende Handlungen (sofern sie Teil eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung sind):
- Tötung eines Menschen,
- Menschenhandel,
- Vertreibung einer rechtmäßig aufhältigen Person in einen anderen Staat oder ein anderes Gebiet unter Verstoß gegen eine allgemeine Regel des Völkerrechts,
- Folterungen von Personen, die in Gewahrsam genommen wurden oder sich in sonstiger Weise unter der Kontrolle der Gewahrsamsperson befinden,
- Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und Zwangsprostitution,
- Verschwindenlassen von Personen im Auftrag oder mit Billigung eines Staates oder einer politischen Organisation.
25.3.8.1.3.2
Völkermord zählt ebenfalls zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Völkermord verübt, wer in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören, schwere Menschenrechtsverletzungen begeht (vgl. Artikel 6 Römisches Statut, § 6 VStGB).
25.3.8.2 Straftat von erheblicher Bedeutung
§ 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b) bestimmt, dass Personen, die Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen haben, keine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Die Vorschrift eröffnet die Möglichkeit, auch bei Straftaten von erheblicher Bedeutung nach dem allgemeinen Strafrecht die Aufenthaltserlaubnis und die damit verbundenen weiteren Vorteile zu versagen.
25.3.8.2.1
Eine Straftat von erheblicher Bedeutung liegt vor, wenn die Straftat mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität angehört, den Rechtsfrieden empfindlich stört und geeignet ist, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen. Zur Bewertung der konkreten Tat können als Anhaltspunkte auf die Tatausführung, das verletzte Rechtsgut, die Schwere des eingetretenen Schadens sowie die von dem Straftatbestand vorgesehene Strafandrohung abgestellt werden.
25.3.8.2.2
Die Voraussetzungen für eine Straftat von erheblicher Bedeutung liegen regelmäßig bei Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag vor, daneben auch bei Raub, Kindesmissbrauch, Entführung, schwerer Körperverletzung, Brandstiftung und Drogenhandel. Dagegen scheiden Bagatelldelikte als Straftaten von erheblicher Bedeutung aus, z. B. Diebstahl geringwertiger Sachen und geringfügige Sachbeschädigungen.
25.3.8.3 Verstöße gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen
25.3.8.3.1
Nach § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) ist Personen die Aufenthaltserlaubnis zu verwehren, wenn sie den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen, wie sie in der Präambel und in Artikel 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind, zuwider handeln. Die ausdrückliche Bezugnahme auf die Präambel sowie Artikel 1 und 2 der Charta soll verdeutlichen, dass nur fundamentale Verstöße als Ausschlussgründe in Betracht kommen. Dazu zählen Handlungen, die geeignet sind, den internationalen Frieden, die internationale Sicherheit oder die friedliche Koexistenz der Staaten zu gefährden sowie schwere und anhaltende Menschenrechtsverletzungen.
25.3.8.3.2
Ein Verstoß gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen kann auf zweierlei Weise festgestellt werden: Zum einen, indem die fragliche Handlung ausdrücklich als Handlung, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstößt, eingestuft wird, etwa im Rahmen einer Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen; zum anderen, wenn die Handlung auf der Grundlage von Völkerrechtsinstrumenten als schwerwiegende Verletzung grundlegender Menschenrechte angesehen wird.
25.3.8.3.3
Da Artikel 1 und 2 der Charta der Vereinten Nationen im Wesentlichen das Verhältnis zwischen Staaten festlegen, kommt die Anwendung der Ausschlussklausel i. d. R. nur bei Personen mit entsprechender Machtposition in Betracht. Dazu gehören in erster Linie Regierungsmitglieder, führende Angehörige des Staatsapparats, hochrangige Militärangehörige und Guerillaführer. Im Einzelfall kann aber auch ein Einzelner, der nicht in einen Staatsapparat oder eine nichtstaatliche Organisation eingebunden ist, die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) erfüllen, wenn er Mittel und Methoden einsetzt, die zu kriegsgleichen Zerstörungen führen oder die die friedliche Koexistenz der Staatengemeinschaft in sonstiger Weise beeinträchtigten. Die Vorschrift ist jedoch nicht anwendbar auf Straftäter, deren Wirken diesen Schweregrad nicht erreicht, selbst wenn sie Kapitalverbrechen begehen. In diesen Fällen liegen i. d. R. die Ausschlussklauseln „Verbrechen gegen die Menschlichkeit" oder „Straftat von erheblicher Bedeutung" vor.
25.3.8.3.4
Die Ausschlussklausel ist unter den oben genannten Voraussetzungen auch bei Begehen terroristischer Handlungen anwendbar. Allerdings fallen nur Handlungen darunter, die in ihren Dimensionen potenziell friedensgefährdend sind oder massivste Menschenrechtsverletzungen nach sich ziehen (vgl. auch ausschließlich auf den internationalen Terrorismus bezogene Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, z. B. Resolutionen 1373 (2001), 1377 [2001]). Terroristische Taten, die die Voraussetzungen von §§ 129a und 129b StGB erfüllen, erreichen die vorgenannten Dimensionen i. d. R. nicht. Sie sollten daher bei der Beurteilung, ob eine Handlung i. S. d. von § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe c) auszuschließen ist, nicht herangezogen werden. Als Ausschlusstatbestände kommen hier aber regelmäßig § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) (Verbrechen gegen die Menschlichkeit) oder § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b) (Straftat von erheblicher Bedeutung) in Betracht.
25.3.8.4 Gefährder
§ 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe d) schließt Personen, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, von der Gewährung einer Aufenthaltserlaubnis aus. Darunter fallen Personen, die die Allgemeinheit gefährden, insbesondere durch erhebliche Straftaten. Eine strafrechtliche Verurteilung ist nicht erforderlich. Allerdings ist im Falle einer Verurteilung zu einer mindestens dreijährigen Haftstrafe in Anlehnung an die entsprechenden flüchtlingsrechtlichen Regelungen des § 60 Absatz 8 die Aufenthaltserlaubnis regelmäßig zu versagen. In den übrigen Fällen kommt es auf den Einzelfall an. Bei Personen, die die Sicherheit des Landes gefährden, ist erforderlich, dass die von ihnen ausgehende Gefahr sich gegen das Staatsgefüge richtet. Dies ist etwa bei terroristischen Aktivitäten der Fall (vgl. im Einzelnen Nummer 54.2.2.2 bis 54.2.2.2.2). Im Unterschied zu den anderen Ausschlussgründen in § 25 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a) bis c) reicht für die Anwendung des Buchstaben d) die bloße Feststellung einer in der Vergangenheit begangenen Straftat oder Gefährdung nicht aus. Vielmehr muss zusätzlich immer eine vom Betreffenden weiterhin ausgehende Gefahr festgestellt werden. Bei Straftätern ist anhand der Gesamtumstände des Einzelfalles zu prüfen, ob die Gefahr besteht, dass auch in Zukunft Straftaten begangen werden. Die bloße Aussetzung einer Strafverbüßung zur Bewährung ist alleine noch nicht ausreichend für die Annahme, dass der Betreffende künftig ein straffreies Leben führen wird.
25.4 Vorübergehender Aufenthalt und Verlängerung
25.4.1 Aufenthaltserlaubnis für vorübergehenden Aufenthalt aus dringenden humanitären oder politischen Gründen
25.4.1.1
Die Regelung bietet die Möglichkeit der Erteilung einer befristeten Aufenthaltserlaubnis für einen vorübergehenden Aufenthalt. Ein Daueraufenthalt soll über diese Vorschrift nicht eröffnet werden. Der Ausländer muss sich bereits im Bundesgebiet befinden und darf nicht vollziehbar ausreisepflichtig sein. In Fällen, in denen der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist, kann bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis nur nach § 23 Absatz 1, § 23a, § 25 Absatz 4a, § 25 Absatz 5, § 104a oder § 104b erteilt werden. Darüber hinaus kann die Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Betracht kommen (siehe Nummer 60a.2.3). Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 setzt voraus, dass der Ausländer – nicht vollziehbar ausreisepflichtig ist, – einen nur vorübergehenden Aufenthalt beabsichtigt und – dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder – erhebliche öffentliche Interessen seine vorübergehende Anwesenheit in Deutschland erfordern.
25.4.1.2
Zudem müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 vorliegen; die Ausländerbehörde kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (§ 5 Absatz 3 Satz 2, siehe aber bezüglich des Abweichens vom Erfordernis der Lebensunterhaltssicherung Nummer 5.3.2.1); von § 5 Absatz 4 darf nicht abgewichen werden (dazu siehe Nummer 5.4). Im Rahmen des Ermessens sind insbesondere der geltend gemachte Aufenthaltszweck, die Länge des angestrebten vorübergehenden Aufenthalts, die bisherigen rechtmäßigen Aufenthalte im Bundesgebiet und die öffentlichen Interessen an der Anwesenheit im Bundesgebiet zu berücksichtigen.
25.4.1.3
Darüber hinaus entscheidet die Ausländerbehörde über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach pflichtgemäßem Ermessen (siehe dazu Nummer 25.4.1.6 f.); es besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis. Anders als bei § 25 Absatz 4a und § 25 Absatz 5 ist bei § 25 Absatz 4 das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 Absatz 1 zwingend zu berücksichtigen.
25.4.1.4
Bei der Prüfung, ob dringende humanitäre Gründe vorliegen, ist auf die individuell-konkreten Umstände des Einzelfalls abzustellen. Es kommen nur inlandsbezogene Gründe in Frage, nicht erheblich i. S. d. § 25 Absatz 4 Satz 1 sind zielstaatsbezogene Gründe, insbesondere das Vorliegen von Abschiebungshindernissen oder Gefahren für den Ausländer, die im Falle seiner Rückkehr im Heimatstaat auftreten können. Nicht berücksichtigt werden kann damit insbesondere die Unmöglichkeit, im Ausland eine zur Bestreitung des Lebensunterhalts erforderliche Arbeit zu finden. Der Ausländer muss sich aufgrund besonderer Umstände in einer auf seine Person bezogenen Sondersituation befinden, die sich deutlich von der Lage vergleichbarer Ausländer unterscheidet. Das Verlassen des Bundesgebiets in einen Staat, in dem keine entsprechenden Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten bestehen, ist kein dringender humanitärer Grund i. S. d. § 25 Absatz 4 Satz 1.
25.4.1.5
Nach § 25 Absatz 4 Satz 1 kommt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nur in Betracht, wenn ein vorübergehender, also ein zeitlich begrenzter Aufenthalt angestrebt wird; begehrt der Ausländer einen Daueraufenthalt oder einen zeitlich nicht absehbaren Aufenthalt im Bundesgebiet, so kommt eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 nicht in Betracht.
25.4.1.6
Bei der Ermessensentscheidung sind daher nur solche Umstände zu berücksichtigen, die ihrer Natur nach einen vorübergehenden Aufenthalt notwendig machen; Umstände, die auf einen Daueraufenthalt abzielen, sind grundsätzlich nicht berücksichtigungsfähig. Im Rahmen der Ermessensentscheidung sind die privaten Interessen des Ausländers und die öffentlichen Interessen abzuwägen. Als Gesichtspunkte können die Dauer des Voraufenthalts, der Grund für die Ausreisepflicht und die Folgen einer alsbaldigen Abschiebung für den Ausländer herangezogen werden.
25.4.1.6.1
Dringende humanitäre oder persönliche Gründe können z. B. in folgenden Fällen angenommen werden:
- Durchführung einer medizinischen Operation oder Abschluss einer ärztlichen Behandlung, die im Herkunftsland nicht oder nicht in ausreichendem Maße gewährleistet ist,
- vorübergehende Betreuung erkrankter Familienangehöriger,
- die Regelung gewichtiger persönlicher Angelegenheiten, wie z. B. die Teilnahme an einer Beisetzung oder dringende Regelungen im Zusammenhang mit dem Todesfall eines Angehörigen oder die Teilnahme an einer Gerichtsverhandlung als Zeuge; bei der Teilnahme an Gerichtsverhandlungen als Verfahrenspartei kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an,
- Abschluss einer Schul- oder Berufsausbildung, sofern sich der Schüler oder Auszubildende bereits kurz vor dem angestrebten Abschluss, i. d. R. also zumindest im letzten Schul- bzw. Ausbildungsjahr befindet.
25.4.1.6.2
Dringende humanitäre oder persönliche Gründe wird man z. B. regelmäßig nicht annehmen können
- allein wegen der Integration in die deutschen Lebensverhältnisse, wie etwa bei Vorliegen von guten deutschen Sprachkenntnissen,
- beim Erlöschen der Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck, weil die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, insbesondere bei Verlust des Arbeitsplatzes oder der Wohnung,
- wenn der Ausländer die Absicht hat, eine Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck zu beantragen, er die Voraussetzungen hierfür gegenwärtig aber noch nicht erfüllt,
- allein wegen der gerichtlichen Durchsetzung von Ansprüchen oder der Durchführung eines Vaterschaftsanfechtungsprozesses (siehe aber Nummer 25.4.1.6.1),
- bei einem Petitionsverfahren, das die Fortsetzung des Aufenthalts zum Gegenstand hat.
25.4.1.6.3
Erhebliche öffentliche Interessen können vorliegen, wenn
- der Ausländer als Zeuge in einem Gerichts- oder Verwaltungsverfahren benötigt wird,
- der Ausländer mit deutschen Behörden bei der Ermittlung von Straftaten vorübergehend zusammenarbeitet, sich insbesondere in einem Zeugenschutzprogramm befindet; zu beachten ist insoweit auch § 25 Absatz 4a, der eine Sonderregelung für die Erteilung einer vorübergehenden Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel enthält,
- der Aufenthalt des Ausländers zurWahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland fortgesetzt werden soll, wie z. B. aufgrund sicherheitspolitischer Interessen deutscher Sicherheitsbehörden, außenpolitischer oder auch sportpolitischer Interessen, etwa wenn es um die Fortsetzung des Aufenthalts eines sportpolitisch bedeutenden ausländischen Sportlers geht.
25.4.1.7
Dringende humanitäre oder persönliche Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen erfordern den weiteren Aufenthalt nur, wenn das mit dem weiteren Aufenthalt des Ausländers angestrebte Ziel nicht auch in zumutbarer Weise im Ausland erreicht werden kann.
25.4.1.8
Die Aufenthaltserlaubnis wird grundsätzlich für den Zeitraum erteilt, der für die Erreichung des Aufenthaltszwecks erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1), längstens für sechs Monate, solange sich der Ausländer noch nicht mindestens 18 Monate rechtmäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat (§ 26 Absatz 1 Satz 1).
25.4.1.9
Eine Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur ausnahmsweise in Betracht, wenn wider Erwarten der Aufenthaltszweck noch nicht erreicht werden konnte. Eine Verfestigung des Aufenthalts nach § 26 Absatz 4 Satz 1 ist nicht zuzulassen (§ 8 Absatz 2), da es sich nach der Zweckbestimmung um einen nur vorübergehenden Aufenthalt handelt. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, ist die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2 möglich, ebenso die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zu einem anderen Aufenthaltszweck.
25.4.1.10
Die Aufenthaltserlaubnis erlischt nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 51 ff., siehe Nummer 51.1), insbesondere wenn der Ausländer einen Asylantrag stellt (§ 51 Absatz 1 Nummer 8).
25.4.1.11
Ein Familiennachzug zu Ausländern, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 sind, wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3, siehe hierzu Nummer 29.3.3), da sich der Ausländer nur vorübergehend im Bundesgebiet aufhalten wird.
25.4.1.12
Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.
25.4.2.1
§ 25 Absatz 4 Satz 2 schafft eine Ausnahmemöglichkeit für die Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen bereits ein rechtmäßiger Aufenthalt besteht und das Verlassen des Bundesgebietes für den Ausländer eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde. Es handelt sich hierbei um eine eigenständige Möglichkeit der Verlängerung, unabhängig von den Voraussetzungen des § 25 Absatz 4 Satz 1. Die Verlängerung darf daher unabhängig von der Grundlage des ursprünglichen Aufenthaltstitels und abweichend von den Bestimmungen nach § 8 Absatz 1 und 2 erteilt werden. Verlängerungen sind in diesen Fällen somit auch dann möglich, wenn der Ausländer z. B. im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen ist, deren Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, oder wenn die zuständige Behörde die Verlängerung ursprünglich durch Nebenstimmung ausdrücklich ausgeschlossen hat. Die Ausländerbehörde hat sich mit einer anderen Ausländerbehörde ins Benehmen zu setzen, die zuvor die Verlängerung ausgeschlossen hatte.
25.4.2.2
Die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2 setzt voraus, dass – der Ausländer im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis oder Fiktionsbescheinigung (§ 81 Absatz 4) ist, – sich im Bundesgebiet aufhält und – das Verlassen des Bundesgebiets aufgrund besonderer Umstände des Einzelfalles eine außergewöhnliche Härte bedeuten würde.
25.4.2.3
Grundsätzlich müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen nach § 5 erfüllt sein. Zwingende Versagungsgründe oder Erteilungsverbote sind grundsätzlich anzuwenden; die Ausländerbehörde kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (siehe Nummer 5.3.2), von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe Nummer 5.4). Es besteht kein Anspruch auf Verlängerung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2; die Ausländerbehörde entscheidet vielmehr nach pflichtgemäßem Ermessen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Vorschrift für Ausnahmefälle reserviert ist. Bei Ausländern, deren Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, darf gemäß § 10 Absatz 3 vor der Ausreise eine Aufenthaltserlaubnis grundsätzlich nicht erteilt werden; ebenso ist das Einreise- und Aufenthaltsverbot nach § 11 anwendbar.
25.4.2.4.1
Eine außergewöhnliche Härte setzt voraus, dass der Ausländer sich in einer individuellen Sondersituation befindet, aufgrund derer ihn die Aufenthaltsbeendigung nach Art und Schwere des Eingriffs wesentlich härter treffen würde als andere Ausländer, deren Aufenthalt ebenfalls zu beenden wäre. Dies kommt z. B. in Betracht, wenn den Ausländer im Falle der Ausreise ein außergewöhnlich schweres Schicksal trifft, das sich von gewöhnlichen Schwierigkeiten unterscheidet, denen andere Ausländer im Falle der Ausreise ausgesetzt wären. Eine außergewöhnliche Härte kann sich für den Ausländer auch aus besonderen Verpflichtungen ergeben, die für ihn im Verhältnis zu dritten im Bundesgebiet lebenden Personen bestehen, z. B. wenn die dauerhafte Betreuung eines plötzlich pflegebedürftigen Angehörigen notwendig ist, der Deutscher ist oder sich als Ausländer im Bundesgebiet dauerhaft rechtmäßig aufhält. Eine Aufenthaltserlaubnis kann nach § 25 Absatz 4 Satz 2 nur verlängert werden, wenn die Aufenthaltsbeendigung als regelmäßige Folge des Ablaufs bisheriger anderer Aufenthaltstitel unvertretbar wäre und dadurch konkret-individuelle Belange des Ausländers in erheblicher Weise beeinträchtigt würden. Bei der Beurteilung, ob die Beendigung des Aufenthalts eines in Deutschland aufgewachsenen Ausländers eine außergewöhnliche Härte darstellt, kann nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auch dem Umstand Bedeutung zukommen, inwieweit der Ausländer in Deutschland verwurzelt ist. Das Ausmaß der Verwurzelung bzw. die für den Ausländer mit einer „Entwurzelung" verbundenen Folgen seien unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Vorgaben der Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 1 GG sowie der Regelung des Artikels 8 EMRK zu ermitteln, zu gewichten und mit den Gründen, die für eine Aufenthaltsbeendigung sprechen, abzuwägen. Dabei sei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten. Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts gibt verschiedene Kriterien vor, die bei der Prüfung der Verwurzelung eingrenzend zu berücksichtigen sind und die es nahe legen, die Annahme einer außergewöhnlichen Härte aufgrund von Verwurzelung restriktiv zu handhaben:
- Der Aufenthaltsdauer kommt erhebliches Gewicht zu, es sei denn, die Legitimität des Aufenthalts war belastet, z. B. durch Täuschungen der Ausländerbehörde über die Staatsangehörigkeit.
- Im Rahmen der Prüfung der beruflichen Verwurzelung ist zu prüfen, inwieweit der Ausländer durch seine Berufstätigkeit in der Lage ist, den Lebensunterhalt für sich und seine Familie dauerhaft zu sichern, wobei auch ein in der Vergangenheit liegender, lang anhaltender Bezug öffentlicher Sozialleistungen zu berücksichtigen ist. Von Belang ist außerdem, ob der Ausländer eine Berufsausbildung absolviert hat und ihn diese Ausbildung ggf. für eine Berufstätigkeit qualifiziert, die nur oder bevorzugt in Deutschland ausgeübt werden kann. Bei der sozialen Integration sind unter anderem die Bindungen bzw. Kontakte des Ausländers außerhalb der Kernfamilie zu berücksichtigen. Falls Familienmitglieder des Ausländers bereits ausgereist sind, ist hier die Frage zu klären, ob ein Zusammenleben mit ihnen im Herkunftsland möglich und zumutbar ist.
25.4.2.4.2
Die Annahme einer außergewöhnlichen Härte kann nicht darauf gestützt werden, dass der Ausländer eine Arbeitsstelle in Aussicht hat. Ebenso wenig gehören politische Verfolgungsgründe (§ 60 Absatz 1 Satz 1) und Abschiebungsverbote i. S. v. § 60 Absatz 2 bis 7 zum Prüfungsrahmen des § 25 Absatz 4 Satz 2 (keine die außergewöhnliche Härte bestimmenden persönlichen Merkmale). Gleiches gilt für Gesichtspunkte, die zu Aufenthaltsrechten nach anderen Härtefallklauseln führen, wie § 31 Absatz 2 oder § 25 Absatz 4 Satz 1 (z. B. Ausbildungsaufenthalte zur Absolvierung einer Prüfung).
25.4.2.4.3
Das Nichtvorliegen der tatbestandlichen Voraussetzungen anderer aufenthaltsrechtlicher Vorschriften rechtfertigt die Annahme einer außergewöhnlichen Härte nicht. Beruft sich beispielsweise ein Ausländer auf allgemeine Verhältnisse im Heimatstaat (z. B. Katastrophen- oder Kriegssituation), ist nur auf die Lage vergleichbarer Fälle aus oder in diesem Staat abzustellen. Allgemeine Verhältnisse im Heimatstaat, die unter Umständen der Ausreise des Ausländers aus dem Bundesgebiet vorübergehend entgegenstehen, fallen unter die Regelungsbereiche der §§ 23, 24 oder 60a Absatz 1.
25.4.2.4.4
Eine außergewöhnliche Härte wird z. B. regelmäßig in den folgenden Fällen nicht anzunehmen sein:
- nur weil der Ausländer eine Arbeitsstelle in Aussicht hat,
- bei Beendigung eines Ausbildungsaufenthalts vor Abschluss der Prüfung,
- im Falle fehlender Erwerbsmöglichkeiten im Zielstaat.
25.4.2.5
Sind die Voraussetzungen für das Vorliegen einer außergewöhnlichen Härte nicht gegeben, kann unter Umständen die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 1 für einen vorübergehenden Aufenthalt oder die Erteilung einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 3 in Frage kommen.
25.4.2.6
Die Aufenthaltserlaubnis wird nur für den Zeitraum erteilt, der für die Erreichung des Aufenthaltszwecks erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1) und längstens für jeweils drei Jahre verlängert (§ 26 Absatz 1 Satz 1). Eine Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 möglich. Die Aufenthaltserlaubnis erlischt nach den allgemeinen Vorschriften (§§ 51 ff., siehe Nummer 51.1), insbesondere wenn der Ausländer einen Asylantrag stellt (§ 51 Absatz 1 Nummer 8).
25.4.2.7
Ein Familiennachzug zu Ausländern, die im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4 Satz 2 sind, wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3). Familienangehörige, die bereits eine im Bundesgebiet bestehende familiäre Lebensgemeinschaft mit dem betreffenden Ausländer führen, können – sofern sie die Voraussetzungen des § 25 Absatz 4 Satz 2 in eigener Person erfüllen – ebenfalls eine solche Aufenthaltserlaubnis erhalten.
25.4.2.8
Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.
25.4a Aufenthaltserlaubnis für Opfer von Menschenhandel
25.4a.0.1
Nach dieser Regelung kann Opfern von Menschenhandel eine befristete Aufenthalterlaubnis erteilt werden. Sie dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illegalen Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen Behörden kooperieren (ABl. EU Nummer L 261 S. 19, so genannte Opferschutzrichtlinie) und steht in engem Zusammenhang mit weiteren Regelungen des Aufenthaltsgesetzes (§ 5 Absatz 3 Satz 1, § 26 Absatz 1 Satz 3, § 50 Absatz 2a, § 52 Absatz 5, § 72 Absatz 6, § 87 Absatz 5 und § 90 Absatz 4), des AsylbLG (§ 1 Absatz 1 Nummer 3 AsylbLG) und der BeschVerfV (§ 6a BeschVerfV). Es handelt sich hierbei um eine humanitäre Sonderregelung, da sie wie § 23a und § 25 Absatz 5 gerade auf vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer Anwendung findet. Ausländer, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, benötigen diesen Aufenthaltstitel regelmäßig nicht. Die Wahrung der Sicherheitsinteressen der Opferzeugen bzw. -innen von Menschenhandel sowie deren angemessene Unterstützung bilden eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Verfolgung der Täter und damit für die Erreichung des mit § 25 Absatz 4a sowie der zugrunde liegenden Richtlinie verfolgten gesetzgeberischen Zieles. Im Zuge der Anwendung des § 25 Absatz 4a sowie der damit zusammenhängenden weiteren Regelungen ist daher grundsätzlich immer darauf zu achten, dass Ausländer, die als potenzielle Zeugen anzusehen sind, nicht durch eine Offenlegung dieser Eigenschaft zusätzlichen Gefährdungen oder Stigmatisierungen ausgesetzt werden.
25.4a.0.2
Zur Frage der Anwendbarkeit von § 25 Absatz 4a in Bezug auf Freizügigkeitsberechtigte siehe Nummer 2.2, 2.3 sowie Nummer 13.2.2.1 FreizügG/EU-VwV.
25.4a.1
Der Ausländer muss die folgenden Tatbestandsvoraussetzungen erfüllen:
25.4a.1.1
Nach § 25 Absatz 4a Satz 1 muss der Ausländer Opfer einer Straftat nach den §§ 232, 233 oder § 233a StGB sein. Opfer einer solchen Straftat ist nur die „andere Person" i. S. v. §§ 232 und 233 StGB. Die Art der Begehung der Straftat ist unerheblich, Versuch und Teilnahme sind daher auch erfasst. Dabei setzt § 25 Absatz 4a jedoch nicht voraus, dass der Täter bereits rechtskräftig verurteilt wurde. Vielmehr reicht es aus, dass die Staatsanwaltschaft oder ihre Ermittlungspersonen wegen zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte für eine solche Straftat, die auf konkreten Tatsachen beruhen (Anfangsverdacht gemäß § 152 Absatz 2 StPO), ermitteln (vgl. Nummer 50.2a.1.1). Um dem gesetzgeberischen Ziel dieser Regelung gerecht zu werden, die neben dem Schutz der Opfer von Menschenhandel auch der Erleichterung des Strafverfahrens gegen die Täter dient, muss während des Ermittlungsverfahrens die Möglichkeit bestehen, den Zeugen einen Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 4a zu erteilen.
25.4a.1.2
§ 25 Absatz 4a Satz 1 enthält eine Ausnahme von § 11 Absatz 1 Satz 2, d. h. eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a kann auch im Falle eines Einreise- und Aufenthaltsverbotes sowie dann erteilt werden, wenn der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig ist.
25.4a.2.0
Weitere, kumulativ zu erfüllende Tatbestandsmerkmale sind in § 25 Absatz 4a Satz 2 enthalten. Dabei ist die Ausländerbehörde an die tatbestandlichen Feststellungen der Staatsanwaltschaft und des Gerichtes gebunden.
25.4a.2.1
Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 1 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn die vorübergehende Anwesenheit des Ausländers im Bundesgebiet für ein Strafverfahren wegen dieser Straftat von der Staatsanwaltschaft oder dem Strafgericht für sachgerecht erachtet wird, weil ohne seine Angaben die Erforschung des Sachverhalts erschwert wäre.
25.4a.2.2
Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 2 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn der Ausländer jede Verbindung zu den Personen, die beschuldigt werden, die Straftat begangen zu haben, abgebrochen hat. Wie aus § 52 Absatz 5 Nummer 3 deutlich wird, kommt es darauf an, dass das Opfer den Kontakt abgebrochen hat. Eine weiterhin bestehende Verbindung auf Veranlassung der Täter kann unerheblich sein. Bei der Beurteilung ist insbesondere zu beachten, ob das Opfer sich auf Grund bestehender Zwänge zur Aufrechterhaltung des Kontaktes genötigt sieht und dabei versucht, diesen auf ein Minimum zu beschränken. Ein Kontakt, der nur durch die Täter initiiert oder aufrechterhalten wird, z. B. durch Telefonanrufe, ist unerheblich; zu berücksichtigen ist insbesondere, ob der Täter den Kontakt zum Opfer aufnimmt, um eine Einbeziehung des Opfers als Zeuge im Strafverfahren zu behindern. Zu berücksichtigen ist auch, dass nicht selten Personen des näheren sozialen Umfelds des Ausländers im Herkunftsland in die Tat involviert sind, von denen eine vollständige Distanzierung z. B. mit Rücksicht auf eventuelle Repressalien gegenüber Angehörigen des Opfers nur schwer möglich ist.
25.4a.2.3
Nach § 25 Absatz 4a Satz 2 Nummer 3 darf die Aufenthaltserlaubnis nur erteilt werden, wenn der Ausländer seine Bereitschaft erklärt hat, in dem Strafverfahren wegen der Straftat als Zeuge auszusagen. Zu berücksichtigen ist aber, dass nach den Regeln des Strafprozessrechts ein Zeuge, wenn er von der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht geladen wird, eine Erscheinens- und Aussagepflicht hat, die auch erzwungen werden kann (vgl. §§ 51, 70 und § 161a StPO). Nur in den Fällen, in denen ein Zeuge die Aussage aufgrund einer gesetzlichen Regelung verweigern darf, kann er entscheiden, ob er von diesem Recht Gebrauch machen oder dennoch aussagen möchte. In Betracht kommen hierfür das in § 52 StPO geregelte Zeugnisverweigerungsrecht, wenn der Zeuge in einem nahen persönlichen Verhältnis zum Beschuldigten steht, und das Auskunftsverweigerungsrecht nach § 55 StPO, wenn er sich durch seine Aussage der Gefahr aussetzen würde, selbst strafrechtlich verfolgt zu werden. Beide Rechte verhindern aber nicht, dass der Zeuge vor Gericht oder der Staatsanwaltschaft auf deren Ladung zu erscheinen hat. Hierauf soll hingewiesen werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Durch die Bezugnahme auf die konkrete Straftat und das konkrete Strafverfahren wird deutlich, dass eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a nur auf Grund eines Strafverfahrens erteilt werden darf, das zumindest eine der aufgeführten Straftaten zum Gegenstand hat. Auf Strafverfahren mit ausschließlich anderem Verfahrensgegenstand gegen dieselben Täter ist § 25 Absatz 4a nicht anwendbar. Siehe hierzu jedoch die Duldungsregelung des § 60a Absatz 2 Satz 2 (vgl. Nummer 60a.2.2).
25.4a.3
Die Prüfung der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung nach § 5 Absatz 1 und 2 ist durch § 5 Absatz 3 Satz 1 weitgehend eingeschränkt (vgl. Nummer 5.3.1.2). Neben § 5 Absatz 4 findet lediglich die allgemeine Regelerteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 3 Anwendung, wonach der Aufenthalt des Ausländers nicht aus einem sonstigen Grund die Interessen der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigen oder gefährden darf. Ungeachtet seiner Funktion als Generalklausel sind die in Nummer 1 bis 2 und 4 genannten – isolierten – Gründe in Nummer 3 auf Tatbestandsebene nicht erfasst; ansonsten liefe die Einschränkung des § 5 Absatz 3 Satz 1 leer.
25.4a.4
Auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a besteht kein Anspruch. Vielmehr sieht § 25 Absatz 4a ein Ermessen der Ausländerbehörde vor.
25.4a.4.1
In die Interessenabwägung ist einerseits das Interesse der Strafverfolgungsbehörden an dem für das Strafverfahren notwendigen Aufenthalt des Ausländers einzubeziehen. Andererseits ist dies mit der Gefährdung der Interessen der Bundesrepublik Deutschland nach § 5 Absatz 1 Nummer 3 abzuwägen. Überwiegen die Interessen der Strafverfolgungsbehörden am Aufenthalt des Ausländers, wird die Aufenthaltserlaubnis erteilt.
25.4a.4.2
Im Rahmen dieser Interessenabwägung nur nachrangig zu berücksichtigen sind die persönlichen Interessen des Ausländers, da es sich bei § 25 Absatz 4a um einen Spezialtatbestand handelt, der primär die Erleichterung der Durchführung des gegen den Täter gerichteten Strafverfahrens beinhaltet. Darüber hinausgehende Fragen des Opferschutzes werden nicht im Verfahren der Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25 Absatz 4a abgehandelt, sondern werden im Rahmen der Prüfung der Erteilung eines anderen Aufenthaltstitels (z. B. nach § 25 Absatz 5 oder § 25 Absatz 3 aufgrund eines Abschiebungsverbotes nach § 60 Absatz 2 und 7 Satz 1) bzw. einer Duldung nach § 60a Absatz 2 Satz 1, 2 oder 3 berücksichtigt. Der häufig erheblichen Gefährdung von Menschenhandelsopfern, die mit den Strafverfolgungsbehörden kooperieren, ist im Rahmen dieser Vorschriften auch nach Abschluss des Strafverfahrens bzw. nach deren Ausscheiden aus der Rolle des Opferzeugen Rechnung zu tragen. Einer Rückkehr dieser Personen in das Herkunftsland stehen häufig erhebliche Gefährdungen für Leib, Leben oder Freiheit durch das im Herkunftsland verbliebene Umfeld der Täter entgegen. Zudem trifft dieser Personenkreis bei Bekannt werden der (erzwungenen) Tätigkeit in der Prostitution und anderer Umstände, die die Ausländer zu Zeugen im Menschenhandelsverfahren machen, im Herkunftsland häufig auf eine schwerwiegende soziale Ausgrenzung und Stigmatisierung. Dieser Sondersituation, die sich im kausalen Zusammenhang mit der Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden ergibt, soll im Rahmen der Prüfung der sonstigen in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen, soweit dies dort möglich ist, Rechnung getragen werden.
25.4a.5
Die Aufenthaltserlaubnis wird nach § 26 Absatz 1 Satz 3 für jeweils sechs Monate erteilt und verlängert; in begründeten Fällen ist eine längere Geltungsdauer zulässig (vgl. Nummer 26.1.3.1 f.).
25.5 Aufenthaltserlaubnis in Fällen, in denen die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist
25.5.0
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach Ermessen gemäß § 25 Absatz 5 Satz 1 setzt voraus, dass
- der Ausländer vollziehbar ausreisepflichtig i. S. d. § 58 Absatz 2 ist und sich noch im Bundesgebiet aufhält,
- seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist, – mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist und
- der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist.
Darüber hinaus müssen die allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen grundsätzlich erfüllt sein; die Ausländerbehörde kann nach Ermessen von § 5 Absatz 1 und 2 abweichen (Nummer 5.3.2). Von § 5 Absatz 4 darf hingegen nicht abgewichen werden (siehe Nummer 5.4). Der Ausländer hat keinen Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltserlaubnis; die Ausländerbehörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen (siehe hierzu Nummer 25.5.6). Bei Vorliegen eines Einreise- oder Aufenthaltsverbots kann abweichend von § 11 Absatz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Die Ausländerbehörde, die über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 entscheidet, hat zu prüfen, ob die mit Ausweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung verbundenen Zwecke bereits erreicht worden sind. Handelt es sich um eine andere Ausländerbehörde als diejenige, die die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen verfügt hat, ist in sinngemäßer Anwendung von § 72 Absatz 3 Einvernehmen mit der Ursprungsbehörde herzustellen (vgl. Nummer 11.1.3.2.1). Ist die Zweckerreichung nicht eingetreten, ist zu prüfen, ob die Interessen des Ausländers die öffentlichen Interessen an der Erreichung des mit der den Aufenthalt beendenden Verfügung angestrebten Zwecks erheblich überwiegen. Bei Ausländern, deren Asylantrag gemäß § 30 Absatz 3 AsylVfG als offensichtlich unbegründet abgelehnt worden ist, darf gemäß § 10 Absatz 3 vor der Ausreise eine Aufenthaltserlaubnis nicht erteilt werden.
25.5.1.1
Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis kommt nur in Betracht, wenn der Ausländer nicht ausreisen kann. Der Begriff der Ausreise entspricht dem in § 25 Absatz 3 verwendeten Begriff, vgl. Nummer 25.3.5.2.
25.5.1.2
Die Unmöglichkeit aus tatsächlichen Gründen betrifft z. B. Fälle der Reiseunfähigkeit, unverschuldeter Passlosigkeit und unterbrochener oder fehlender Verkehrsverbindungen, sofern mit dem Wegfall der Hindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen ist.
25.5.1.3.1
Die Unmöglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen umfasst inlandsbezogene Ausreise- hindernisse, beispielsweise bei Vorliegen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung, wenn die ernsthafte Gefahr besteht, dass sich der Gesundheitszustand des Ausländers durch die Ausreise als solche, also unabhängig von den spezifischen Verhältnissen im Abschiebestaat, erheblich verschlechtert. Da es im Rahmen des § 25 Absatz 5 auf die Unmöglichkeit nicht nur der Abschiebung, sondern auch der freiwilligen Ausreise ankommt, sind Gesundheitsverschlech- terungen, die lediglich im Fall der zwangsweisen Rückführung drohen, nicht ausreichend für die Erteilung eines Titels. Eine dem Ausländer wegen der spezifischen Verhältnisse im Herkunftsland drohende Gefahr einer wesentlichen Gesundheitsverschlechterung, der nicht durch eine geeignete Behandlung begegnet werden kann, fällt i. d. R. nicht in den Anwendungsbereich des § 25 Absatz 5, sondern ist bei der Prüfung zielstaatsbezogener Abschiebungsverbote nach § 60 Absatz 2, 3, 5 oder 7 zu berücksichtigen und kann zur Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 führen.
25.5.1.3.2
Nur wenn die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 3 i.V.m. § 60 Absatz 5, Absatz 7 Satz 1 wegen Vorliegens eines Einreise- und Aufenthaltsverbots nach § 11 Absatz 1 nicht möglich ist, verbleibt ein Anwendungsbereich für zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote im Rahmen des § 25 Absatz 5. Die Ausländerbehörden sind jedoch an die unanfechtbare Feststellung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 2, 3, 5 und 7 gebunden. Im Rahmen der Prüfung, ob eine Unmöglichkeit vorliegt, sind deshalb grundsätzlich nur solche Gefahren zu berücksichtigen, die sich allein als Folge der Abschiebung bzw. der freiwilligen Reise und nicht wegen der spezifischen Verhältnisse im Zielstaat ergeben.
25.5.1.3.3
Selbst wenn die oberste Landesbehörde einen allgemeinen Abschiebestopp nach § 60a Absatz 1 verfügt hat, lässt dies noch keinen Schluss auf die Unmöglichkeit auch einer freiwilligen Ausreise zu. Die oberste Landesbehörde kann sich aus unterschiedlichen Gründen veranlasst sehen, einen Abschiebestopp zu verfügen (vgl. Nummer 60a.1).
25.5.1.4
Ist in absehbarer Zeit mit dem Wegfall des Ausreisehindernisses zu rechnen, darf keine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden. Bei der Entscheidung über die Erteilung eines Aufenthaltstitels ist zu prognostizieren, ob das Ausreisehindernis auch in absehbarer Zeit bestehen wird. Dies würde beispielsweise dann gegeben sein, wenn das Ausreisehindernis seiner Natur nach nicht nur ein vorübergehendes ist. Ist auf Grund der Umstände des Falles erkennbar, dass das Ausreisehindernis für länger als sechs Monate (vgl. § 26 Absatz 1) bzw. für einen unbegrenzten Zeitraum bestehen wird, kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden.
25.5.2
I.d.R. soll bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 25 Absatz 5 Satz 1 eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt ist. Diese Regelung findet auch Anwendung auf Fälle, in denen nach dem Ausländergesetz die Abschiebung seit 18 Monaten ausgesetzt worden ist (vgl. § 102 Absatz 1). Die Aufenthaltserlaubnis ist allerdings nicht schon allein aufgrund Ablaufs der 18-Monats-Frist zu erteilen. Zusätzlich müssen vielmehr die Voraussetzungen nach § 25 Absatz 5 Satz 1 erfüllt sein, insbesondere darf mit dem Wegfall der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu rechnen sein (siehe Nummer 25.5.1.4). Die Soll-Regelung bedeutet, dass grundsätzlich eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist, sofern nicht ein atypischer Ausnahmefall vorliegt. Auf die 18-Monats-Frist sind nur Aufenthaltszeiten anzurechnen, in denen der Ausländer geduldet wurde, nicht aber Zeiten, in denen er über einen Aufenthaltstitel oder eine Aufenthaltsgestattung verfügte. Bei der Beurteilung der Frage, ob von der „Soll"-Regelung des § 25 Absatz 5 Satz 2 abgewichen werden kann, kann die Gewichtigkeit des vom Ausländer ggf. verwirklichten Ausweisungsgrundes und der mit der Ausweisung verfolgte generalpräventive Zweck in derWeise berücksichtigt werden, dass trotz Ablaufs der 18-Monats-Frist die Aufenthaltserlaubnis (noch) nicht erteilt wird, weil auch die Voraussetzungen für die Befristung der Wirkungen der Ausweisung (noch) nicht gegeben wären.
25.5.3
§ 25 Absatz 5 Satz 3 und 4 stellen sicher, dass eine Aufenthaltserlaubnis nur erteilt wird, wenn positiv festgestellt ist, dass der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehindert ist. Verschulden erfordert ein zurechenbares Verhalten des Ausländers. Der Begriff des Verschuldens soll in einem umfassenden Sinn Personen von der Gewährung des Aufenthaltsrechts ausschließen, wenn diese die Gründe für den fortdauernden Aufenthalt selbst zu vertreten haben.
25.5.4
§ 25 Absatz 5 Satz 4 nennt beispielhaft Fälle, in denen von einem Verschulden des Ausländers stets auszugehen ist. Dies trifft bei Täuschung über seine Identität oder Nationalität zu oder wenn er zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der Ausreisehindernisse, beispielsweise die Mitwirkung bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten z. B. durch Zeichnung einer so genannten Freiwilligkeitserklärung oder durch Vorlage der für das Heimreisedokument erforderlichen Fotos, nicht erfüllt. Auch soweit das Ausreisehindernis darauf beruht, dass der Ausländer erforderliche Angaben verweigert hat, ist dies von ihm zu vertreten und schließt die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus. Aus den Beispielen wird deutlich, dass eine schuldhafte Verhinderung oder Verzögerung der Ausreise sowohl in aktivem Tun als auch in Unterlassen bestehen kann. Der Ausländer kann sich danach nicht auf eine passive Rolle zurückziehen, sondern muss im Rahmen des Zumutbaren aktiv tätig werden, um Ausreisehindernisse zu beseitigen. Zumutbar sind dem Ausländer grundsätzlich alle Handlungen, die zur Beschaffung von Heimreisepapieren erforderlich sind und von ihm persönlich vorgenommen werden können. Offensichtlich aussichtslose Anstrengungen zur Beschaffung von Heimreisepapieren sind hingegen unzumutbar. So ist einem Ausländer eine erneute Vorsprache bei der Botschaft seines Heimatlandes nicht zuzumuten, wenn feststeht, dass diese ergebnislos sein würde, nachdem er in der Vergangenheit wiederholt dort erfolglos vorgesprochen hatte und dabei seinen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen war. Eine Unzumutbarkeit ergibt sich nicht aus der Dauer des bisherigen Aufenthalts.
25.5.4.1
Ein Verschulden durch aktives Tun ist z. B. in den folgenden Fällen anzunehmen:
- Täuschung über Identität oder Staatsangehörigkeit,
- Angabe falscher Tatsachen, Missbrauch, Vernichtung oder Unterschlagung von Urkunden oder Beweismitteln,
- Untertauchen zur Verhinderung der aufenthaltsbeendenden Maßnahme, aktiver oder passiver körperlicher Widerstand gegen Vollzugsmaßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung,
- Zusammenwirken mit der Botschaft oder Behörden des Herkunftsstaates, um eine Rückübernahme zu verhindern,
- Verstreichenlassen der Rückkehrberechtigung,
- Entlassung aus der bisherigen Staatsangehörigkeit auf Antrag, ohne gleichzeitig eine neue Staatsangehörigkeit anzunehmen.
25.5.4.2
Ein Verschulden durch Nichtvornahme von zumutbaren Handlungen kann z. B. anzunehmen sein, wenn der Ausländer:
- die für die Ausreise notwendigen ihm bekannten Angaben nicht macht oder verweigert,
- relevante Dokumente oder Beweismittel, über die er verfügt, nicht vorlegt,
- nicht mitwirkt an der Feststellung der Identität und der Beschaffung von Heimreisepapieren,
- kraft Gesetzes aus der bisherigen Staatsangehörigkeit entlassen wurde (z. B. wegen Nichtableistung des Wehrdienstes) und keinen Wiedererwerb beantragt,
- eine von der Botschaft seines Herkunftsstaates geforderte „Freiwilligkeitserklärung" nicht abgibt.
25.5.5
Durch das dem Ausländer zurechenbare Handeln oder Unterlassen muss die Ausreise verhindert oder wesentlich verzögert worden sein. Das Verhalten des Ausländers muss damit für die Schaffung oder Aufrechterhaltung eines aktuell bestehenden Ausreisehindernisses zumindest mitursächlich sein.
25.5.6
Die Ausländerbehörde hat bei der Ausübung des Ermessens ausgehend von der Zielvorgabe des § 1 Absatz 1 u. a. folgende Kriterien heranzuziehen:
- die Dauer des Aufenthalts in Deutschland,
- die Integration des Ausländers in den Arbeitsmarkt durch den Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses oder einer selbständigen Arbeit,
- die Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik Deutschland, wobei abhängig von der Dauer des Aufenthalts in Deutschland zumindest einfache Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden können.
25.5.7
Die Aufenthaltserlaubnis wird nur für den Zeitraum, der für die Erreichung des Aufenthaltszwecks erforderlich ist (§ 7 Absatz 2 Satz 1), erteilt. Auf § 26 Absatz 1 Satz 1 wird hingewiesen. Eine Aufenthaltsverfestigung ist unter den Voraussetzungen des § 26 Absatz 4 möglich.
25.5.8
Der Familiennachzug zu einem Ausländer, der eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 5 besitzt, wird nicht gewährt (§ 29 Absatz 3 Satz 3).
25.5.9
Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bestimmt sich nach § 21 Absatz 6 bzw. nach § 39 Absatz 3.