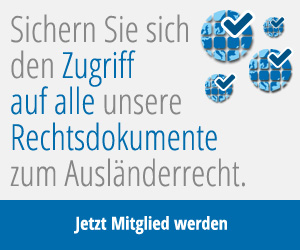Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz (Kommentierung)
- Gesetz:
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
- Paragraph:
- § 6 Visum
- Autor:
- Holger Winkelmann
- Stand:
- Winkelmann in: OK-MNet-AufenthG (17.04.2014)
V. Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz
1. Verwaltungsverfahren
2. Erlöschen, Widerruf und Rücknahme
3. Rechtsschutz
> End
V. Verwaltungsverfahren und Rechtsschutz
1. Verwaltungsverfahren
48
Für das Visumverfahren zuständig sind die vom Auswärtigen Amt ermächtigten Auslandsvertretungen (§ 71 Abs. 2; Art. 2 Nr. 9, 4 Abs. 1, 7 VK - Konsulate -), für das Ausnahmevisum an der Grenze die Grenzbehörden (§§ 14 Abs. 2, 71 Abs. 3 Nr. 2; Art. 35, 36 VK). Das einheitliche Visum ist grds. von der Visastelle des Konsulates desjenigen Staates auszustellen, in dem das Hauptreiseziel liegt (Art. 5 Abs. 1 a VK). Die weitere Prüfung der Zuständigkeit bestimmt sich nach den weiteren Alternativen des Art. 5 VK sowie der Art. 6 - 8 VK.
Nach § 15 Abs. 1 AufenthG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 SGK ist die Einreise zu verweigern, wenn diese nach § 14 Abs. 1 Nr. 2a AufenthG unerlaubt erfolgen soll und daher nach Art. 34 Visakodex zu annullieren. Dies ist auch dann der Fall, wenn der Reisende nicht im Besitz des Visums ist, dass seinem Hauptreisezweck entspricht, sofern dieses Schengen-Visum durch falsche Angaben gegenüber dem ausstellenden Konsulat erschlichen wurde (VG München, B. v. 04.12.13 – M 23 S 13.5250 –, juris).
49
Die Erteilung des einheitlichen Visums richtet sich mittlerweile ausschließlich nach EU-Recht (Rn. 10 ff), ergänzt durch nationales Verfahrensrecht. Die Visumverweigerung erfolgt nach Art. 32 VK, wobei die Abs. 2 und 3 erst mit 5. 4. 2011 Anwendung fanden (vgl. Art. 58 Abs. 5 VK, Inkrafttreten); für Visaverweigerungen an der Grenze gilt Art. 35 Abs. 6, 7 i.V.m. Art. 58 Abs. 5 VK. Das VwVfG findet auf Verfahren vor den Auslandsvertretungen keine Anwendung (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VwVfG). Das einheitliche Visum wird nach den Bestimmungen des VK auf einer einheitlichen EU-Visummarke mit einem Lichtbild erteilt (vgl. VO/EG 1683/95 i.d.F. der VO/EG 856/2008). Gebühren für die Ausstellung des Visums konnten nur nach § 46 AufenthV erhoben werden, wenn die Vorgaben des VK beachtet wurden (durch AufenthV2011 angeglichen): Die Gebühren für ein Visum an der Grenze betragen nach Art. 16 VK 60 Euro für den Antragsteller und 35 Euro für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren; befreit sind Kinder unter 6 Jahren, Schüler, Studenten, Forscher, Vertreter gemeinnütziger Organisationen bis 25 Jahre. Von der Gebühr können Kinder von 6–12 Jahren befreit werden, ebenso Inhaber von amtlichen Pässen und Personen bis 25 Jahre, die an bestimmten Veranstaltungen gemeinnütziger Organisationen teilnehmen. Insoweit bedurfte es einer Änderung/Anpassung der §§ 50, 52 und 69 AufenthV. Nach Antragsrücknahme vor Eintritt in die Sachbearbeitung und für die Ablehnung ist eine Bearbeitungsgebühr in derselben Höhe fällig, es sei denn, die Ablehnung beruht auf der Unzuständigkeit der Behörden oder der mangelnden Handlungsfähigkeit des Antragstellers (§ 49 AufenthV).
50
Nebenbestimmungen können auch nachträglich verfügt werden (§ 12 Abs. 2 AufenthG). Um mögliche finanzielle Risiken auszuschließen, kann im Wege des Ermessens auch auf das Mittel der Kaution zurückgegriffen werden (Teipel, ZAR 1995, 162). Mit dieser Zahlung können später entstehende Kosten für Unterhalt und Abschiebung gedeckt werden, wenn diese nicht anders abgesichert werden können, z.B. durch eine Verpflichtung nach § 68 AufenthG. Die Kautionszahlung kann entweder durch Bedingung oder Auflage zum Visum angeordnet oder aber durch öffentlichrechtlichen Vertrag vereinbart werden. Während bei der Bedingung ein unerwünschter Schwebezustand eintritt, erfordert die Auflage u.U. Vollstreckungsmaßnahmen; beide Nachteile werden durch die Vereinbarung vermieden. Die Kaution braucht grds. nicht verzinst zu werden (OVG NW, U. v. 16. 8. 2000 – 17 A 1013/99 –). Eine nachträgliche Befristung ist nicht vorgesehen, da § 7 Abs. 2 Satz 2 AufenthG nicht anwendbar ist (Hermann/Keicher, ZAR 2005, 196; vgl. auch Rn. 50).
51
Die Ablehnung des Visumantrags bedarf der Schriftform (Art. 32 Abs. 2, Abs. 3 i.V.m. Anh. VI VK; § 77 Abs. 2 AufenthG), bislang ausgenommen war die Versagung an der Grenze (§ 77 Abs. 2 2. HS AufenthG2010), die bereits seit dem 5. 4. 2011 auch mit Ablehnungsbescheid und Begründung anhand des Formblattes (Anh. VI VK) mitzuteilen war. Insoweit überlagerte die EU-VO innerstaatliches Recht. Es ist nunmehr ausdrücklich ein Rechtsmittel nach deutschem Recht vorzusehen (Art. 32 Abs. 3 Satz 1 VK; s. näher unter Nr. 3 Rechtsschutz).
52
Die für die Visumerteilung zuständigen Behörden entscheiden in eigener Verantwortung über den Sichtvermerk aufgrund der jeweiligen einschlägigen materiellen Vorschriften der §§ 5 ff (näher Teipel, ZAR 1995, 162). Art. 9 (Modalitäten für das Einreichen eines Antrags), Art. 10 (Allgemeine Regeln für das Einreichen eines Antrags) und Art. 11 VK (Antragsformular) sowie das weitere Verfahren richtet sich nach dieser VO. Die Prüfung der Einreisevoraussetzungen und die Risikobewertung erfolgen nach Art. 21 VK (s.o. Rn. 25f). An Verwaltungsvorschriften der Länder sind sie dabei nicht gebunden (BVerwG, B. v. 15. 3. 1985 – 1 A 6/85 –). Auch Entscheidungen und Stellungnahmen anderer Behörden sind grds. nicht für sie verbindlich, es sei denn, dies ist gesetzlich so bestimmt. Nach außen hin haben nur sie die getroffene Entscheidung zu vertreten (zum Rechtsschutz Rn. 62f). Im internen Entscheidungsprozess der Auslandsvertretungen sind u.U. die Ausländerbehörde und die Bundesagentur für Arbeit sowie weitere Stellen beteiligt. Ohne deren Beteiligung kann die Auslandsvertretung aber entscheiden, wenn ein Visum ohnehin nicht in Betracht kommt, weil z.B. zwingende Versagungsgründe gegeben sind.
53
Die Auslandsvertretungen können bestimmte Daten, die im Visumverfahren von der deutschen Auslandsvertretung oder von der für die Entgegennahme des Visumantrags zuständigen Auslandsvertretung eines anderen Schengen-Staates anfallen, gem. § 73 AufenthG den dort genannten Sicherheitsbehörden zur Prüfung von Versagungsgründen übermitteln. Die Auslandsvertretung muss vor Erteilung eines Visums die Zustimmung der für den vorgesehenen Aufenthaltsort zuständigen Ausländerbehörde einholen, wenn der Aufenthalt länger als drei Monate dauern soll, eine Erwerbstätigkeit beabsichtigt ist oder im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung Daten an die Sicherheitsbehörde zu übermitteln sind (§ 31 Abs. 1 Satz 1 AufenthV). Im Falle der Vermittlung durch einen Verband, eine Organisation, Forschungseinrichtung oder andere Stelle kann auch die Zustimmung der insoweit örtlich zuständigen Ausländerbehörde eingeholt werden (§ 31 Abs. 2 AufenthV). Ausnahmen von der obligatorischen Zustimmung gelten u.a für Spätaussiedler mit Aufnahmebescheid und deren Ehegatten und Abkömmlinge, für bestimmte Stipendiaten, Wissenschaftler, Forscher, Gastarbeitnehmer, für Seeleute eines Schiffs unter deutsches Flagge und Mitglieder ausländischer Streitkräfte (§§ 33–36 AufenthV). Eine Zustimmung der obersten Landesbehörde ersetzt die der Ausländerbehörde und macht diese überflüssig (§ 32 AufenthV). Schließlich sind Erwerbstätige ausgenommen, deren Tätigkeit nicht als Erwerbstätigkeit gilt (§ 37 AufenthV i.V.m. § 16 BeschV; Rückausnahme im Zusammenhang mit der Terrorismusbekämpfung). Neu eingefügt wurde § 73a AufenthG (Unterrichtung über die Erteilung von Visa, s. dort), der Art. 31 VK umsetzt. Unterrichtungen der anderen Schengen-Staaten über erteilte Visa können über die zuständige Stelle an den Bundesnachrichtendienst, das Bundesamt für Verfassungsschutz, den Militärischen Abschirmdienst, das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt zur Prüfung übermittelt werden, ob der Einreise und dem Aufenthalt des Visuminhabers die in § 5 Abs. 4 AufenthG genannten Gründe oder sonstige Sicherheitsbedenken entgegenstehen.
54
Maßgeblich für das Visum wie für die Zustimmung der Ausländerbehörde sind die für den jeweiligen Aufenthaltstitel einschlägigen Vorschriften. An die Zustimmung der Ausländerbehörde ist die Auslandsvertretung insofern gebunden, als das Visum ohne Zustimmung nicht erteilt werden darf; ob die Zustimmung zu Recht versagt worden ist, wird erforderlichenfalls in dem Rechtsstreit gegen die Bundesrepublik Deutschland nach Beiladung der für die Ausländerbehörde verantwortlichen Körperschaft entschieden (BVerwG, U. v. 18. 9. 1984 – 1 A 4/83 – BVerwGE 70, 127; U. v. 16. 5. 1983 – 1 C 56/79 – BVerwGE 67, 173). Das Visum kann aber trotz Zustimmung versagt werden, wenn die formellen oder materiellen Voraussetzungen für den begehrten Aufenthaltstitel – entgegen der Ansicht der Ausländerbehörde – nicht gegeben sind (BVerwG, B. v. 15. 3. 1985 – 1 A 6/85 –). Ausschlaggebend und nach außen verantwortlich ist demnach die Auslandsvertretung. Dies gilt auch und erst recht, wenn die Ausländerbehörde außerhalb des § 31 Abs. 1 AufenthV um Auskunft gebeten wurde, z.B. bei einem kurzfristigen Verwandtenbesuch.
55
Das Zustimmungsverfahren bleibt behördenintern, auch wenn in der Behördenpraxis die Einholung der Zustimmung oft von dem Ausländer selbst beantragt wird oder wenn die Ausländerbehörde (nach § 31 Abs. 3 AufenthV) eine Vorabzustimmung erteilt oder ablehnt. Unterbleibt ein eigentlich notwendiges Zustimmungsverfahren, ist der Verwaltungsakt der Auslandsvertretung dennoch nicht nichtig (Rechtsgedanke des § 44 Abs. 3 Nr. 4 VwVfG), allenfalls anfechtbar. Die Mitwirkung der Ausländerbehörde kann bis zum Erlass eines Widerspruchsbescheids oder, falls der Widerspruch ausgeschlossen ist, bis zur Klageerhebung nachgeholt werden mit der Folge, dass der Verfahrensfehler geheilt ist (Rechtsgedanke des § 45 Abs. 1 Nr. 5, Abs. 2 VwVfG). Weder die Zustimmung noch deren Versagung stellen einen Verwaltungsakt dar und sind deshalb nicht selbständig angreifbar; denn sie treffen keine Regelung mit verbindlicher Außenwirkung (vgl. § 35 VwVfG). Im Verwaltungsprozess führt die obligatorische Mitwirkung der Ausländerbehörde zur notwendigen Beiladung (§ 65 Abs. 2 VwGO) der sie tragenden Körperschaft. Die Zustimmung ist bis zur Erteilung des Visums rücknehmbar oder widerrufbar, falls die Voraussetzungen nicht vorlagen oder nachträglich entfallen; später erscheint die Rücknahme ausgeschlossen (betr. letzterem a.A. Teipel, ZAR 1995, 162).
56
Ebenso verhält es sich bei einer Konsultation, die bei SIS-Ausschreibung und bei Herkunft aus Problemstaaten erforderlich wird (Art. 22 VK). Sofern dabei u.a die Sicherheitsbehörde eingeschaltet werden, bleibt auch diese Mitwirkung intern. Eine ablehnende Stellungnahme des konsultierten Staats bindet die Auslandsvertretung nicht. Diese hat vielmehr selbständig über Art. 5 Abs. 1 d SGK zu entscheiden und kann auch von der Möglichkeit des Art. 5 Abs. 4 c SGK Gebrauch machen (s. Rn. 38). Die Mitgliedstaaten teilen nach dem vorgesehenen Verfahren der Kommission die Einführung oder Rücknahme der Verpflichtung zur vorherigen Konsultation mit, die ihrerseits die Mitgliedstaaten unterrichtet. Die Informationen sind nach Art. 53 Abs. 1 d und Abs. 2 VK auch der Öffentlichkeit regelmäßig zur Verfügung zu stellen. Nach Art. 22 Abs. 3, Abs. 4 i.V.m. Art. 53 Abs. 1 d und Art. 47 Abs. 1 g VK ist zur Verbesserung der Sichtbarkeit und im Hinblick auf ein einheitliches Auftreten im Bereich der gemeinsamen Visumpolitik eine gemeinsame Webseite über die Visabestimmungen im Schengenraum eingerichtet worden. Über diese Webseite werden der breiteren Öffentlichkeit alle einschlägigen Informationen zur Beantragung eines Visums zur Verfügung gestellt werden (vgl. Erwägungsgrund Nr. 23 VK und Rede von Henrik Lax, MDEP, Berichterstatter Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres anlässlich der Plenardebatte am 1. 4. 2009 in Brüssel. Winkelmann, Kommentierung zum Visakodex, MNet; http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_visa_en.htm). Diese Plattform ist bislang ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.
57
Schließlich ist auch die Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit zum Zwecke der Zustimmung zu einer Beschäftigung eine rein interne Angelegenheit. Die Auslandsvertretung hat für eine beabsichtigte unselbständige Erwerbstätigkeit ein Zustimmungsverfahren nach denselben Grundsätzen einzuleiten wie die Ausländerbehörde; Abs. 2 und 3 des § 4 gelten auch für das Visum. Die Bundesagentur entscheidet gegenüber der Auslandsvertretung in derselben Weise wie gegenüber der Ausländerbehörde. Über den Zuzug eines Selbständigen befindet die Auslandsvertretung ebenso wie die Ausländerbehörde (dazu § 21).
2. Erlöschen, Widerruf und Rücknahme
58
Die allgemeinen Bestimmungen über Erlöschen, Widerruf und Rücknahme (§§ 51, 52) gelten für die Aufenthaltstitel nach § 4 Abs. 1 Satz 2 AufenthG (ohne Schengen-Visum, aber inklusive des nationalen Visums). Seit Anwendung des VK richtet sich die Annullierung und Aufhebung eines Visums nach Art. 34 VK, dementsprechend erhält der SGK in Anh. V Teil A eine sprachliche Änderung. Die Annullierung kommt in Frage, wenn die Erteilungsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Ausstellung schon nicht vorlagen (VG Augsburg, B. v. 31.03.2011 – Au 1 S 11.377 –, juris, zur Zulässigkeit der Klage und zur Annullierungsentscheidung wegen arglistiger Täuschung im Visumverfahren und beabsichtigtem Daueraufenthalt), während die Aufhebung die Situation betrifft, in der die Voraussetzungen zum Gebrauch des Visums nach Einreise nicht mehr erfüllt werden. Das Visum kann zu diesem Zweck auch durch einen anderen Mitgliedstaat als den Ausstellerstaat annulliert oder aufgehoben werden (Unterrichtungspflicht). Der Visuminhaber selbst kann auch um Aufhebung des Visums ersuchen (Art. 34 Abs. 3 VK). Überwiegender Zweck der Annullierung ist es, den Inhaber des Visums davon abzuhalten, in das Gebiet der Mitgliedstaaten einzureisen. Somit entsprach diese Maßnahme dem Widerruf vor der Einreise gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AufenthG2005. Der Aufhebung entsprach im AufenthG z.B. dem Widerruf nach § 52 Abs. 7 AufenthG2007, soweit der Entschluss zur unerlaubten Erwerbstätigkeit eines Schengenvisuminhabers nach der Visumantragstellung gefasst wurde. Die Nichtvorlage einer oder mehrerer Belege für die Antragstellung nach Art. 14 Abs. 3 i.V.m. Anh. II VK darf nicht automatisch zur Annullierung oder Aufhebung führen. Insoweit gilt für die Grenzbehörde der Prüfungsmaßstab des Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 i.V.m. Anh. I SGK. Im Falle der Visumannullierung oder -aufhebung nach Art. 34 Abs. 6, 7 VK ist die Anwendung des Standardformulars nach Anh. VI und die Rechtsmittelregelung seit 5. 4. 2011 anwendbar (vgl. Art. 58 Abs 5 VK). Art. 34 VK ist unmittelbar anwendbar, mit dem Ergebnis, dass entgegenstehende Normen im AufenthG seit 5. 4. 2010 verdrängt wurden. Damit galten die bisherigen nationalen Vorschriften des § 77 Abs. 1 Satz 2 AufenthG (Schriftform des Widerrufs), § 84 Abs. 1 Nr. 6, Abs. 2 Satz 1 (kein Suspensiveffekt des Widerrufs; Wirksamkeit des VA), § 51 Abs. 1 Nr. 4 (Erlöschen des Aufenthaltstitel) und § 52 AufenthG (Widerruf) nicht mehr. Es gilt daher seit 5. 4. 2010 § 80 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO (Winkelmann, Kommentierung zum Visakodex, MNet).
![]() Kommentierung zum Visakodex (VO (EG) Nr. 810/2009
Kommentierung zum Visakodex (VO (EG) Nr. 810/2009
§ 84 Abs. 1 Nr. 6 AufenthG wurde durch das ÄndG2011 folglich gestrichen.
59
Unsicher kann erscheinen, welche Folgen die Nichtbeachtung der einzelnen Beschränkungen und der Fortfall der Voraussetzungen des einheitlichen Visums haben. Dabei ist zu beachten, dass die Rechte nach Art. 19 SDÜ an den Besitz des Visums und die weiteren Voraussetzungen des Art. 19 gebunden sind. An ausdrücklichen Vorschriften über Erlöschen, Widerruf oder Rücknahme des Schengen-Visums im deutschen Recht konnte verzichtet werden, da insoweit der VK abschließend regelt (vgl. Art. 13 und Anh. V SGK, Art. 34 i.V.m. Anh. VI VK, s. zuvor). Auf von deutschen Auslandsvertretungen erteilte Visa können die Vorschriften des VwVfG wie allgemein auf Maßnahmen im Ausländerrecht nicht angewandt werden (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 VwVfG), wobei die (innerstaatliche) Zuständigkeit hier offenbleiben soll. Die Anwendung des VwVfG scheidet bei einheitlichen Visa anderer Mitgliedstaaten von vornherein aus.
60
Vorab ist festzustellen, dass das Visum sowohl beim Überziehen des Gültigkeitszeitraums als auch beim Überschreiten der Aufenthaltsdauer ungültig wird. Auf beide Zeiträume ist es nämlich festgelegt. Auch die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit führt, wenn sie nicht nach dem Recht des Aufenthaltsstaats erlaubt ist (z.B. nach § 16 BeschV) oder wird, dazu, dass das Visum den Aufenthalt nicht mehr deckt (vgl. insoweit die fehlende Voraussetzung des Art. 5 Abs. 1 e SGK). In den ersten beiden Fällen bedarf es indes keines Eingriffsakts, da der Geltungsbereich des Visums nicht mehr eingehalten ist. In Bezug auf die Erwerbstätigkeit bedarf es zwingend der Annullierung oder der Aufhebung nach Art. 34 VK, da trotz des Wegfalls des Reiserechts noch keine vollziehbare Ausreisepflicht besteht. Entfällt nämlich eine der absolut zwingenden Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 1 SGK oder wird nachträglich festgestellt, dass sie schon anfänglich nicht gegeben war, wird das Visum damit nicht ohne weiteres ungültig oder nichtig; insoweit wird auf den formalen Aspekt abgestellt. Der Nichtbesitz gültiger Grenzübertrittspapiere ist gleichbedeutend mit dem Überschreiten von Geltungsbereich oder -dauer (so auch Hailbronner, § 6 AufenthG Rn. 40; Westphal/Stoppa, a.a.O., S. 339). Konstitutive – unabdingbare – Voraussetzungen für die Inanspruchnahme sind jedenfalls der Pass (Abs. 1 a), das Visum/der Aufenthaltstitel (Abs. 1 b), die SIS-Ausschreibung (Abs. 1 d) und die Gefahr (Abs. 1 e). Die Voraussetzung über genügend Mittel nach Abs. 1 c verfügen zu müssen, würde zum Erlöschen führen können, wenn der Aufenthalt überhaupt nicht mehr legal gesichert werden könnte. Zu beachten ist jedoch bei Art. 19 SDÜ (anders als in vergleichbaren Fällen der Art. 20 Abs. 1, 21 Abs. 1 SDÜ), dass die Ausreisepflicht zunächst nicht nach § 50 Abs. 1 AufenthG vollziehbar ist, da ein (auch ein nicht von Deutschland ausgestelltes) Schengen-Visum das Erfordernis eines Aufenthaltstitels gemäß § 4 Abs. 1 Satz 1 AufenthG erfüllt (ausführlich Winkelmann, ZAR 2010, 270f). In diesen Fällen bedarf es jedenfalls eines Feststellungsaktes der zuständigen Behörde, um das bestehende Aufenthaltsrecht zu beseitigen (zum weiteren Verfahren der Beendigung des illegalen Aufenthaltes und zur Verfahrensweise bei Rückkehrentscheidungen gem. RL 2008/115/EG bei Winkelmann, Beitrag zur Umsetzung der Rückführungsrichtlinie, MNet.).
![]() Zur nationalen Umsetzung der Rückführungsrichtlinie
Zur nationalen Umsetzung der Rückführungsrichtlinie
Das entsprach z.B. auch der Verpflichtung nach § 52 Abs. 7 AufenthG2010, der den zwingenden Widerruf des Schengenvisums bei unerlaubter Erwerbstätigkeit vorsah. Der Identitätsnachweis kann zudem von den Mitgliedstaaten unabhängig von dem Visum verlangt werden. Nach Art. 5 Abs. 1 a SGK wird der Besitz eines oder mehrerer gültiger Grenzübertrittpapiere für die Erteilung des Visums vorgeschrieben. Unabhängig davon bleiben die vom SDÜ und SGK nicht berührten Verpflichtungen zum Nachweis der Identität an den Außengrenzen bestehen; nur die Personenkontrollen an den Binnengrenzen sind entfallen (Art. 20 SGK).
61
Transnational verbindlich wirkende Regeln über die Behandlung nachträglicher Veränderungen der Erteilungsgrundlagen existierten zunächst weder im EU-Recht im Allgemeinen noch für das SDÜ/SGK im Besonderen. Eine einschlägige Regelung über Annullierung, Aufhebung und Verkürzung der Geltungsdauer (s.u.) des Schengen-Visums durch einen Beschluss des Schengen-Exekutivausschusses von 1993 gehörte zum Schengen-Besitzstand und ist als EU-Recht mittlerweile mit Art. 34 VK verbindlich vorgeschrieben. Im Beschluss war die Aufhebung des Visums auch durch einen anderen Staat schon vorgesehen (Hailbronner, § 7 AufenthG Rn. 38). Es fehlte indes an der notwendigen Umsetzung für Deutschland (ebenso betr. nachträgliche Befristung Hermann/Keicher, ZAR 2005, 196). Die Regelung des Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Anh V SGK ist nicht als self-executing Norm zu verstehen und stellt daher keine Eingriffsbefugnis dar (so auch Westphal/Stoppa, a.a.O., S. 490). Zur Wirkungsweise der Einreiseverweigerung und der Annullierung näher unter § 15. Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit (ehemals Art. 31 des Entwurfs zum VK: „Die Grenzkontrollbehörden können die Gültigkeitsdauer eines Visums verkürzen, wenn nachgewiesen ist, dass der Inhaber nicht über ausreichende Mittel zur Bestreitung seines Lebensunterhalts während der ursprünglich vorgesehenen Aufenthaltsdauer verfügt) der Verringerung der Gültigkeitsdauer von Visa ist nicht weiter verfolgt worden und ist in der Schlussfassung des VK gestrichen worden. Die Verkürzung kann aber als „Minusmaßnahme“ anstelle einer sofortigen vollständigen Annullierung bzw. Aufhebung geboten sein. Eine solche zeitliche Verkürzung der Gültigkeitsdauer bietet den Vorteil, die durch eine „Beseitigung“ des Visums geschaffene neue Situation eines Aufenthalts ohne Visum im Schengengebiet zu regeln. Die Verkürzung der Gültigkeitsdauer kann so individuell vorgenommen werden, um unproblematisch und rechtmäßig durch andere Schengenstaaten durchzureisen und damit seine Ausreise zu vollziehen (Winkelmann, Beitrag zum Visakodex, a.a.O.).
3. Rechtsschutz
62
Im Visumverfahren hat ein Ausländer dieses Verfahren einschließlich eines sich an das Verwaltungsverfahren gegebenenfalls anschließenden Klageverfahrens grds. vom Ausland aus zu betreiben. Denn eine vorläufige Ermöglichung des Aufenthalts im Bundesgebiet während eines noch laufenden Visumsverfahrens ist im AufenthG nicht vorgesehen. Gegen die Versagung eines Visums zu touristischen Zwecken sowie eines Visums oder eines Passersatzes an der Grenze war die Klage noch bis zum 4. 4. 2011 ausgeschlossen, weil diese Maßnahmen nach § 83 AufenthG unanfechtbar waren (kritisch zur bisherigen Unanfechtbarkeit der Visumversagung an der Grenze bei Sennekamp in: Kluth/Hund/Maaßen (Hrsg.), Zuwanderungsrecht, S. 635, Rn. 9). Im Falle der Ablehnung der Schengen-Visumerteilung an der Außengrenze kann der Betroffene nach §§ 79 ff VwVfG, §§ 42 ff, 68 ff VwGO Widerspruch und Verpflichtungsklage einlegen. Die Auslandsvertretung brauchte die Versagung oder Beschränkung des Visums vor der Einreise bislang nicht zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen (§ 77 Abs. 2 1. HS AufenthG2010). Bei Ablehnung eines Visums zum Familiennachzug war die Auslandsvertretung innerdienstlich gehalten, die Gründe schriftlich mitzuteilen (Lipski, ZAR 2002, 196). Sonst wurde eine Begründung erst auf eine Gegenvorstellung hin gegeben (Teipel, ZAR 1995, 162). Diese Beschränkungen galten auch, wenn die Ablehnung eines einheitlichen Visums auf das Fehlen der Voraussetzungen des Art. 5 SGK gestützt wurde (dazu Westphal/Stoppa, InfAuslR 1999, 361). Wird die Ablehnung mit der Ausschreibung im SIS begründet, kann der Ausländer zusätzlich Auskunft, Berichtigung und Löschung verlangen (Art. 109, 110 SDÜ) und dagegen erforderlichenfalls Klage einreichen (Art. 111 SDÜ). Die Rechte sind zunächst gegenüber den nationalen SIRENE-Büros geltend zu machen. Die Versagung der Erteilung eines Visums bestimmt sich nunmehr – auch für den Fall der Erteilung eines Ausnahmevisums an der Grenze – einheitlich nach dem VK. Für die Ablehnung eines nationalen Visums (Typ D) gilt weiterhin der diesbezüglich angepasste § 83 Abs. 1 Satz 1 AufenthG, wonach die Entscheidung unanfechtbar ist. Zum Verfahren bei Annullierung und Aufhebung s. Nr. 2 Rn. 58f.
63
Einstweiliger Rechtsschutz kann nach § 80 Abs. 5 oder § 123 VwGO in Anspruch genommen werden. Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis u.a dann erlassen, wenn dies zur Abwendung wesentlicher Nachteile oder aus anderen Gründen nötig erscheint. Dem Wesen und Zweck dieses Verfahrens entsprechend kann das Gericht mit einer einstweiligen Anordnung grundsätzlich aber nur vorläufige Regelungen treffen und dem jeweiligen Antragsteller nicht schon in vollem Umfang das gewähren, was Klageziel des Hauptsacheverfahrens ist. Eine solche Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung kommt – mit Rücksicht auf die verfassungsrechtliche Garantie effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG) – vielmehr nur in Ausnahmefällen, und zwar nur dann in Betracht, wenn ein Obsiegen im Hauptsacheverfahren mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist und dem Rechtsschutzsuchenden schwere und unzumutbare, anders nicht abwendbare Nachteile entstünden, zu deren nachträglicher Beseitigung die Entscheidung in der Hauptsache nicht mehr in der Lage wäre (VG Berlin, B. v. 21.06.2011 – 1 L 150.11 V –, juris, mit Hinweis auf BVerfG, U. v. 25. Oktober 1998 – 2 BvR 745.88 –, BVerfGE 79, 69 [74, 77] und v. 25. Juli 1996 – 1 BvR 638.96 ,– NVwZ 1997, S. 479 [480 ff.]; OVG Berlin, B. v. 11. Oktober 2000 – OVG 8 SN 175.00 –, InfAuslR 2001, 81; OVG Berlin-Brandenburg, B. v. 21. Juli 2006 – OVG 3 S 35.06 –).
> Top