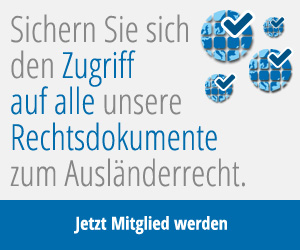Einführung (Kommentierung)
- Gesetz:
- Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz - AufenthG)
- Paragraph:
- § 95 Strafvorschriften
- Autor:
- Holger Winkelmann
- Stand:
- Winkelmann in: OK-MNet-AufenthG (03.05.2013)
I. Entstehungsgeschichte
II. Allgemeines
III. Täter und Teilnehmer
IV. Einzelne Strafnormen
1. Unerlaubter Aufenthalt durch Nichtbesitz eines Passes
2. Unerlaubter Aufenthalt durch Nichtbesitz des erforderlichen Aufenthaltstitels oder
3. Unerlaubte Einreise
4. Verstoß gegen Ausreiseverbot
5. Verstoß gegen Beschränkung politischer Betätigung
6. Keine, unrichtige oder unvollständige Angaben
7. Nichtduldung erkennungsdienstlicher Maßnahmen
8. Verstoß gegen Meldepflicht und a. Beschränkungen und
9. Verstoß gegen räumliche Beschränkung
10. Zugehörigkeit zu geheimem Ausländerverein
11. Strafbarer Aufenthalt bei Erwerbstätigkeit
12. Verstoß gegen Aufenthaltsverbot
13. Erschleichen eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung
I. Entstehungsgeschichte
1
Die Strafvorschriften der §§ 95 ff. haben insbesondere Vorläufer in § 92 AuslG-1990, zurückgehend auf § 13 APVO 1938 (RGBl. 1938 II 1053) und § 11 PassG (BGBl. 1952 I 290; Aurnhammer, S. 7 ff.). Die Vorschrift des § 95 stimmte bis auf die erst aufgrund des Vermittlungsverfahrens während des Gesetzgebungsverfahrens zum ZuwG-2004 in Abs. 1 eingefügte Nr. 6 a mit dem damaligen Gesetzentwurf überein (BT-Drucks. 15/420 S. 34, 15/3479 S. 12).
![]() Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Zuwanderungsgesetz - BT-Drucks. 15/420 v. 07.02.2003
Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Zuwanderungsgesetz - BT-Drucks. 15/420 v. 07.02.2003
Durch das 1. Änderungsgesetz 2005 (Gesetz vom 14.03.2005 (BGBl. I S. 721) wurden notwendige Änderungen unter anderem in § 95 eingefügt (VI a), die das Zusammenwirken von mit dem ZuwG-2004 insgesamt eingeführten Gesetzesänderungen harmonisieren sollte (so auch Westphal/Stoppa, Ausländerrecht für die Polizei, 3. Aufl., S. 667). Die gewonnenen Erfahrungen während der ersten zwei Jahre nach Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes mündeten in das 2. Änderungsgesetz 2007 (BGBl. 2007 Teil I Nr. 42 S. 1970 vom 27.08.2007).
![]() Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union
Die Neueinfügung des Abs. 1a beschäftigt sich im Kern mit der Strafbarkeit des Aufenthalts anlässlich der Aufnahme der Erwerbstätigkeit, sofern der Ausländer nur über ein Schengenvisum verfügt. Damit wurde letztlich der fortwährenden Kritik seitens der Grenzbehörden Rechnung getragen, die auf eine Ungleichbehandlung (Besserstellung) der so genannten „Negativstaater" im Vergleich zu den so genannten „Positivstaatern“ hinwiesen. Die (nicht diskriminierend gemeinte) Terminologie ist aus der Zeit der DVAuslG übernommen worden, nach der in deren Anlage I diejenigen Staaten aufgeführt waren, die zum damaligen Zeitpunkt für einen Kurzaufenthalt vom Erfordernis einer Aufenthaltsgenehmigung befreit waren (= so genannte „Positivstaaten“). In Abgrenzung dazu wurde alle visumpflichtigen Staaten, die heute der Anhang I zu Art. 1 Abs. 1 VO (EG) Nr. 539/2001 (EUVisumVO) entsprechen „Negativstaaten“ genannt. Im europäischen Sprachgebrauch sind neben „positive“ and „negative“ States auch „states of black list and „white list“ gebräuchlich.
2
In der Praxis machten sich vor der Gesetzesänderung Positivstaater wegen unerlaubten Aufenthalts (Abs. 1 Nr. 2) strafbar, wenn sie eine Erwerbstätigkeit in Deutschland aufnahmen und reisten unter bestimmten Voraussetzungen bereits unerlaubt ein (BGH, U. v. 12.6.1990 – 5 StR 614/89 – NStZ 1990, 443; BayObLG, U. v. 30.10.2001 – 4St RR 105/01 ua – EZAR 355 Nr. 29; B. v. 9.10.1996 – 4St RR 163/96 – BayVBl 1997, 123; OLG Karlsruhe, B. v. 23.9.1997 – 2 Ss 123/97 – NStZ-RR 1998, 61; v. Pollern, ZAR 1996, 175), während Negativstaater lediglich eine Ordnungswidrigkeit nach § 404 Abs. 2 Satz 3 SGB III begingen. Der Aufenthalt blieb indes erlaubt (vgl. hierzu § 14), da es in der Frage des erforderlichen Visums lediglich auf die formale Sichtweise ankommt und damit ein durch eine Auslandsvertretung rechtmäßig erteiltes Einreisevisum weiterhin verwaltungsrechtlich bestandskräftig bleibt (BGH U. v. 27.04.2005 – 2 StR 457/04; nachfolgend BGH, B. v. 25.09.2012 – 4 StR 142/12 –, juris). Die Ungleichbehandlung im gleichen Sachverhalt war deshalb möglich, weil Art. 20 Abs. 1 SDÜ als europarechtliches Reiserecht nach ganz überwiegender Auffassung sofort erlischt, sofern die Voraussetzungen nach Art. 5 Abs. 1 SGK nicht (mehr) erfüllt sind, während Art. 19 Abs. 1 SDÜ – auch gestützt durch die nationale Rechtsprechung des BGH – weiterhin ein Aufenthaltsrecht vermittelt (kein automatisches Erlöschen). Somit war die Ergänzung der §§ 15 Abs. 2 Nr. 2a, 95 Abs. 1a primär eine längst notwendige Folge der Kritik der Praxisanwender, der überwiegenden Rechtssprechung der VG und OVG und weiten Teilen der ausländerrechtlichen Literatur und erst in zweiter Linie eine solche der klärenden Rechtssprechung des BGH (ausführlich zu den Konsequenzen des BGH-Urteils bei Schott, Kriminalistik 10/2005, S. 554 f.) wie in der Begründung zum Gesetzentwurf (s.o. Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der EU, S. 116) vertreten wird.
3
Durch das 2. Änderungsgesetz 2007 wurden weiterhin der Tatbestand des Abs. 2 S. 2 um die „Duldung“ und der neue Abs. 6 (rechtsmissbräuchlich erlangte Aufenthaltstitel) ergänzt. Durch das UmsGes2011 wurde Abs. 1 Nr. 2 neu gefasst und dabei an die RL 2008/115/EG (Rückführungsrichtlinie - RüFü-RL) angepasst. Abs. 1a wurde wegen Umsetzung des VK in Bezug auf § 6 redaktionell überarbeitet.
II. Allgemeines
4
Die Vorschrift ist als Bestandteil des Ausländerstrafrechts primär Nebenstrafrecht verwaltungsrechtlicher Prägung und im Zusammenhang mit §§ 96-98, §§ 84 bis 86 AsylVfG, §§ 9, 10 FreizügG/EU und § 77 AufenthV zu sehen (zum früheren Recht Heinrich, ZAR 2003, 166; v. Pollern, ZAR 1987, 12 und 1996, 175), die als spezielle Straftatbestände bzw. Ordnungswidrigkeitentatbestände grundsätzlich Vorrang genießen.
5
Das besondere Ausländerstrafrecht verfolgt als Schutzzweck die Stabilisierung der verwaltungsrechtlichen Ordnungssysteme des AufenthG, der AufenthV, des FreizügG/EU und des AsylVfG (Aurnhammer, S. 76 ff.). Es hatte in der polizeilichen und strafgerichtlichen Praxis mit Zunahme der Regelungsdichte mehr und mehr an Bedeutung gewonnen (Aurnhammer, S. 43 ff; Ahlf, ZAR 1993, 132; Steffen, NZSt 1993, 462; Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Die Kriminalität in der BR Deutschland, Bulletin Nr. 48 vom 12. 6. 1997; Ausländerbeauftragte der Bundesregierung, Bericht über die Lage der Ausländer, September 2002, S. 298; Jahresgutachten 2004, S. 348 ff, 367 ff.). Insbesondere spielen die Sanktionsnormen in der Praxis der Ausländerbehörden, der Grenzbehörden und nicht zuletzt der Strafverfolgungsorgane respektive der Gerichte eine große Rolle (Westphal/Stoppa, a.a.O., S. 666, m.w.N.). Tatbestände der unerlaubte Einreise und des unerlaubten Aufenthalts sind aus ermittlungstechnischer Sicht häufig Ansatzpunkt für weitere qualifizierte Straftaten, die über die Beihilfevorschriften des StGB bis hin zu den Schleusertatbeständen der §§ 96, 97 (siehe dort) und weiteren qualifizierten Straftaten im Bereich des Menschenhandels, der unerlaubten Ausländerbeschäftigung reichen. Diese Deliktfelder prägen in der heutigen Zeit maßgeblich das gesamte Spektrum der Organisierten Kriminalität nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa (vgl. auf europäischer Ebene RL 2002/90/EG (ABl. EG Nr. L 328 S. 17), zur Definition der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum unerlaubten Aufenthalt).
6
Ausweislich der Grundtabelle der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wurden in 2011 78.324 Straftaten gegen das Aufenth-, das Asylverf- u FreizügG/EU festgestellt (2010: 74.153; 2009: 74.241; 2008: 76.704; 2007: 88.621). Die Zahl ist damit nach rückläufigem Trend wieder angestiegen. Davon wurden 24.002 Fälle von unerlaubter Einreise registriert (2010: 21.930; 2009: 25.129; 2008: 25.324; 2007: 28.160), während auf den unerlaubten Aufenthalt 37.514 (2010: 33.247; 2009: 30.368; 2008: 30.946; 2007: 35.134) entfielen. 3.521 mal wurde ein Aufenthaltstitel erschlichen (2010: 3.772; 2009: 3.592; 2008: 4.120; 2007: 5.253). Die Einschleusung von Ausländern nach § 96 schlug 2.218-mal zu Buche (2010; 2.429; 2009: 2.704; 2008: 2.721; 2007: 3.143), während die Einschleusung nach § 97 345-mal registriert wurde (2010: 881; 2009: 508; 2008: 264; 2007: 267). Der Anstieg im Bereich der Einschleusung unter den qualifizierenden Merkmalen der Gewerbs- u. Bandenmäßigkeit spiegelt sich glücklicherweise nicht in § 97 Abs. 1 wider, da es zu keinem erkannten Todesfall in 2011 gekommen ist. Gleichwohl ist die Zahl ein Gradmesser für den Anstieg der Organisiertheit in diesem Deliktfeld. Gegen § 9 FreizügG/EU wurde 205-mal verstoßen (2010: 223; 2009: 165; 2008: 136; 2007: 97). Dieser Anstieg ist erklärbar, da zunächst in den vergangenen Jahren Aberkennungen der Freizügigkeit nach diesem seit 2005 gültigen Gesetz erfolgten, die sich nun auch in den Verstößen gegen die Einreisesperren wieder finden.
Im Jahr 2011 stellte die Bundespolizei insgesamt 7.553 unerlaubt eingereiste Personen auf Flughäfen im Bundesgebiet fest; davon 6.652 Personen bei Flügen aus den Schengen-Staaten; davon 1.814 Personen bei Flügen aus Griechenland und 872 Personen bei Flügen aus Italien. Im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren (Jahr 2010: 1.325 Feststellungen unerlaubter Einreise; Jahr 2009: 1.501 Feststellungen unerlaubter Einreise) ist im Jahr 2011 ein Anstieg der Feststellungen unerlaubter Einreisen aus und über Griechenland zu verzeichnen. Von Januar bis August 2012 stellte die Bundespolizei bereits 1.319 unerlaubt eingereiste Personen aus und über Griechenland fest. Die aus und über Griechenland unerlaubt eingereisten Drittstaatsangehörigen sind insbesondere afghanische, syrische und irakische Staatsangehörige. Im Zusammenhang mit der irregulären Migration hat die Bundespolizei im Jahr 2011 insgesamt 1.960 Urkundendelikte festgestellt. Insbesondere unerlaubt aus und über Griechenland auf dem Luftweg eingereiste Drittstaatsangehörige nutzen häufig ver- bzw. gefälschte europäische Identitätsdokumente, die im Falle einer zulässigen polizeilichen Kontrolle im Inland den Eindruck eines legalen Aufenthalts innerhalb der Europäischen Union vermitteln sollten. Bei lageabhängigen Kontrollen (§ 22 Abs. 1 a BPolG) von Personen aus Griechenland und Italien nahm die Bundespolizei in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 273 Festnahmen vor (Quelle: Bu-Tag Drucks. 17/11015 v. 17. 10. 2012).
![]() Antwort der Bundesregierung zu Kontrollen durch die Bundespolizei an Binnengrenzen
Antwort der Bundesregierung zu Kontrollen durch die Bundespolizei an Binnengrenzen
7
Die gemeinsame Besonderheit aller einschlägigen Vorschriften ist darin zu sehen, dass sie in der einen oder anderen Form an verwaltungsrechtliche Sachverhalte oder Verwaltungsakte anknüpfen und damit ihre Bestimmtheit jeweils sorgfältiger Prüfung bedarf (Aurnhammer, S. 106 ff.). Die Verwaltungsakzessorietät (zum Begriff und weiterführend solcher so genannter Blankettnormen s. Rn 8) des Ausländerstrafrechts wirft unabhängig davon die Frage auf, ob die Strafbarkeit nur von der Wirksamkeit des Verwaltungsaktes oder auch von anderen Kriterien abhängt, insbesondere von dessen Rechtmäßigkeit. Im Wesentlichen unbestritten ist, dass der Verstoß gegen einen nach § 44 VwVfG nichtigen Verwaltungsakt straflos bleibt und die Strafbarkeit zumindest die Vollziehbarkeit des VA voraussetzt (Aurnhammer, S. 120 m.w.N.). Die vom BGH vertretene strikte Abhängigkeit des Strafrechts von denen im Zeitpunkt der Handlung maßgeblichen Verhaltenspflichten (BGH, B. v. 23.7.1969 – 4 StR 371/68 – BGHSt 23, 91; dazu Odenthal, NStZ 1991, 419; Wüterich, NStZ 1987, 107) wird in Literatur und Rechtssprechung vor allem für den Fall der nachträglichen Aufhebung des rechtswidrigen Verwaltungsakte in Zweifel gezogen (Aurnhammer, S. 119 ff m.w.N.; OLG Frankfurt, U. v. 21.8.1987 – 1 Ss 488/86 – EZAR 355 Nr 4).
8
In ausländerrechtlichen Strafrechtsnebengesetzen ergibt sich die Strafbarkeit nicht in Gänze aus der Strafnorm, sondern lässt sich zumeist nur nach Bestimmung des ihnen zugrundeliegenden Verwaltungsunrechts ermitteln (sog. Blankettstrafnormen). Blankettstrafnormen sind im Hinblick auf Art 103 II GG allerdings nicht unproblematisch. Sie sind zwar förmliche Gesetze, enthalten aber nur die Strafbarkeitsvoraussetzungen und das Strafmaß. Alle übrigen Voraussetzungen, so z.B. die Frage des Einreise, des Aufenthalts oder Verstoß gegen eine Wiedereinreisesperre ergeben sich aus den Verwaltungsvorschriften (Maunz/Dürig/Schmidt-Aßmann, Art. 103 Abs. 2 GG, Rn. 199; Satzger, in: Satzger/Schmitt/Widmaier (2009), § 1 Rn 53; Satzger/Langheld in HRRS November 2011 (11/2011). Im Rahmen des nationalen Rechts wird soweit ersichtlich überwiegend mit statischen Verweisungen gearbeitet. Nach der Rechtssprechung des BGH (BGH 5 StR 543/10 - 17.03.2001 (LG Hamburg), BGH HRRS 2011 Nr. 572) sind diese grds. verfassungsrechtlich unbedenklich. Blankettstrafnorm und Verweisungsobjekt unterliegen als „Gesamtwertungsakt“ den verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsanforderungen (Satzger/Langheld, a.a.O.). Der Grundsatz der Konnexität verlangt jedoch eine Gesetzesklarheit, die dem Bestimmtheitsgebot entspricht. Die Gesetzesanwendung bedingt die Beachtung europarechtlicher Bestimmungen, so insbesondere die Auswirkungen des Schengener Besitzstandes (s. dazu ausführlich Winkelmann, ZAR 7/8 2010).
Aufgrund der hohen Komplexität der verwaltungsrechtlichen Bestimmungen und der Verwendung von z.T. dynamischen Verweisungen ist nach Stoppa mittlerweile fraglich, ob die Blankettvorschriften den verfassungsrechtlichen Anforderungen überhaupt noch entsprechen (zur Kritik ausf bei Stoppa in: Huber, AufenthG, Vorb § 95, Rd. 45 f.). Nach dem BGH (BGH 5 StR 543/10 - 17.03.2001 (LG Hamburg), BGH HRRS 2011 Nr. 572) kann eine Strafbarkeit auch auf eine dynamische Verweisung gestützt werden, wenn soweit sich über das europäische Recht durchgehend eine eindeutige, aus einer EG-Verordnung hergeleitete Verbotskette ergibt. Es ist Ausländern nicht von vorneherein unzumutbar, sich in gleicher Weise Kenntnis von europäischen Rechtsvorschriften wie von nationalen zu verschaffen (Satzger/Langheld, a.a.O.). Entgegen der Auffassung des BVerfG (BVerfGE 29, 198, 209 f. Rn 27) sind bei dynamischen Verweisungen auf das Unionsrecht nicht dieselben, sondern gegenüber rein innerstaatlichen dynamischen Verweisungen erhöhte Anforderungen zu stellen; insb. deshalb, weil sich Unsicherheiten auch über den Normgehalt aus den unterschiedlichen verbindlichen Sprachfassungen ergeben können (Satzger/Langheld, a.a.O.). Jedenfalls bei Anwendung der Strafnormen ist zu berücksichtigen, inwieweit dem jeweiligen Ausländer im Rahmen des subjektiven Tatbestandes und des Anspruch an ein normgerechtes Verhalten das nötige Unrechtsbewusstsein vorgeworfen werden kann (s.u. Rn. 10), da strafrechtliche Verweisungen auf insb des Unionsrechts an einem systemimmanenten Bestimmtheitsmangel leiden können (Satzger/Langheld, a.a.O.).
9
§ 95 enthält Vergehenstatbestände, die im Abs. 1 mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und im Abs. 2 mit bis zu 3 Jahren Freiheitsstrafe oder alternativ Geldstrafe bedroht sind. Die angedrohte Freiheitsstrafe von bis zu einem oder bis zu drei Jahren beträgt mindestens einen Monat (§ 38 Abs. 2 StGB). Die Geldstrafe beläuft sich auf fünf bis 360 Tagessätze (§ 40 StGB). Die Strafe für Versuch kann um die Hälfte gemindert werden (§ 50 StGB). Die Einziehung betrifft nur die Urkunden nach Abs. 2 Nr. 2.
10
In jedem Fall ist Vorsatz erforderlich; denn Fahrlässigkeit ist nicht ausdrücklich unter Strafe gestellt (§ 15 StGB; vgl. aber § 98 Abs. 1).
Die Vorsatz begründenden Feststellung müssen aktiv und hinreichend festgestellt und gegen fahrlässiges Handeln abgegrenzt werden (OLG Frankfurt/Main, B. v. 06.09.2011 – 1 Ss 241/11 –, Anwaltskanzlei Weh). Bedingter Vorsatz genügt, wobei eine besondere Belehrung über bestehende Rechtspflichten nicht vorausgesetzt wird (vgl. OLG München, B. v. 30.06.2009 – 4St RR 007/09, 4St RR 7/09 –
„Eine Verurteilung nach § 95 Abs. 1 Nr. 5 AufenthG setzt nicht immer voraus, dass der Ausländer gemäß § 82 Abs. 3 S. 1 AufenthG über die Strafbarkeit falscher Identitätsangaben im Sinne von § 49 Abs. 1 AufenthG belehrt worden ist“).
Fehlende Kenntnis der Rechtsvorschriften schließt Strafe nicht aus. Der Vorsatz kann infolge Irrtums über Tatumstände ausgeschlossen sein (§ 16 StGB, die Strafbarkeit wegen fahrlässiger Begehung bleibt unberührt); AG Tiergarten, U. v. 24.11.2011 - (233 Cs) 35 Js 1464/08 (189/08) -, juris, im Hinblick auf die Annahme der Angeklagten, dass ihre Verteidigerin für sie vorläufigen Rechtsschutz gegen die drohende Abschiebung beantragt hat und dies einen Irrtum über das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen eines anerkannten Rechtfertigungsgrundes darstellt. Fehlendes Bewusstsein der Pflichtwidrigkeit gehört zur Schuldseite (Aurnhammer, S. 174 ff.), schließt also den Vorsatz nicht aus. Bereits aus der Struktur der §§ 16, 17 StGB ergibt sich, dass ein strafrechtlicher relevanter Irrtum entweder ein Tatbestandsirrtum oder ein Verbotsirrtum ist, diese mithin zueinander in einem Exklusivitätsverhältnis stehen (Neumann, JuS 1993,793). Im Allgemeinen genügt aber ein Verbotsirrtum nicht, weil dieser i.d.R. auch bei Ausländern nicht unvermeidbar ist (§ 17 StGB). Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen. Entscheidend ist, ob der Täter aufgrund seiner sozialen Stellung, nach seinen individuellen Fähigkeiten und bei dem ihm zumutbaren Einsatz seiner Erkenntniskräfte und seiner rechtlich-sittlichen Wertvorstellungen das Unrecht der Tat hätte einsehen können (sog. “Gewissensanspannung“ – BGHSt 3, 357; 4, 236.), wobei sich der Rechtsunkundige nicht einfach auf sein unsicheres eigenes Urteil verlassen darf (BGHSt 5, 284; 21, 18), sondern einer Erkundigungspflicht unterliegt (OLG Hamm, NJW 2006, 245; OLG Stuttgart, NJW 2006, 2422). Die Einzelfallumstände und die persönliche Einsichtsfähigkeit entscheiden, ob der Verbotsirrtum vermeidbar ist. Der Irrtum über Tatumstände gewinnt an Bedeutung, wenn der Ausländer nicht in Kenntnis eines normativen Tatbestandsmerkmals handelt und daher nicht vom Appell der Norm angesprochen wird. Dies ist dann der Fall, wenn der Ausländer anlässlich des Erhalts einer Ausweisungsverfügung nicht über deren Rechtsfolgen in einer für ihn verständlichen Sprache aufgeklärt wurde (siehe insoweit auch AG Tiergarten, U. v. 24.11.2008 – 35 Js 1464/08 –; zur Strafbarkeit wegen § 95 Abs. 2 S. 1 siehe unter Rn. 92 f.). Zur Bedeutung der fehlenden Rechtskenntnis bei - vermeintlich - assoziationsberechtigten Türken unter Rn. 19.
Die Begehrung vorläufigen Rechtschutzes kann dazu führen, dass der Betroffene zur Vermeidung einer Strafbarkeit ausreisen müsste, wenn über seinen einstweiligen Rechtsschutzantrag noch nicht entschieden wurde bevor die Ausreisefrist abgelaufen ist. Dies stünde der in Art. 19 IV GG gewährleisteten Garantie eines effektiven Rechtsschutzes entgegen, da der Rechtsschutz durch eine Strafandrohung unterlaufen werden würde. Der Betroffene muss sowohl die Gelegenheit haben, einen Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach § 80 Abs. 5 VwGO zu stellen, als auch das Ergebnis seines Antrages hier in der Bundesrepublik abzuwarten. Solange eine beantragte gerichtliche Entscheidung noch nicht ergangen ist, ist es wegen der einschneidenden Wirkung einer Abschiebung im Interesse effektiven Rechtsschutzes regelmäßig geboten, von der Vollstreckung abzusehen. Der Vollstreckungsschutz kraft Verfassungsrechts suspendiert zugleich den Einsatz strafrechtlicher Mittel. Es läge ein unhaltbarer Widerspruch darin, ein Verhalten strafrechtlich als Unrecht zu bewerten, das die Verfassung legitimiert (AG Tiergarten, U. v. 24.11.2011 – (233 Cs) 35 Js 1464/08 (189/08) –, juris).
11
Das Asylrecht des Art. 16 a Abs. 1 GG kommt anders als Art. 31 Nr. 1 GFK (siehe sogleich) als Rechtfertigungsgrund in Betracht (Aurnhammer, S. 163 ff., a.A. in Bezug auf Art. 31 Abs. 1 GFK Fischer-Lescano/Horst, ZAR 3/2011, die insoweit einen rechtfertigenden Notstand annehmen). Allerdings ist die Rechtswidrigkeit aufgrund der Restriktionen durch Drittstaatenklausel, Flughafenverfahren und § 13 AsylVfG praktisch nur noch in den Fällen ausgeschlossen, in denen der Ausländer nicht aus einem sicheren Herkunftsstaat stammt und auf dem Luftweg einreist, ohne dabei einen sicheren Drittstaat zu berühren.
12
Die unberührt bleibende Geltung von Art. 31 Abs. 1 GFK wirkt sich bei den Tatbeständen des Abs. 1 Nr. 1-3 als persönlicher Strafaufhebungsgrund aus (Aurnhammer, S. 163 f., a.A. Fischer-Lescano/Horst, a.a.O.).
Artikel 31
Flüchtlinge, die sich nicht rechtmäßig im Aufnahmeland aufhalten
1. Die vertragschließenden Staaten werden wegen unrechtmäßiger Einreise oder Aufenthalts keine Strafen gegen Flüchtlinge verhängen, die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in dem ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne von Artikel 1 bedroht waren und die ohne Erlaubnis in das Gebiet der vertragschließenden Staaten einreisen oder sich dort aufhalten, vorausgesetzt, dass sie sich unverzüglich bei den Behörden melden und Gründe darlegen, die ihre unrechtmäßige Einreise oder ihren unrechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen.
Unstreitig ist die Bindungswirkung der GFK als maßgeblichen Teil des internationalen Flüchtlingsschutzes über die Wirkung als Bundesgesetz (Art. 20 Abs. 3 i.V.m. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG). Aber auch ohne die vertragsgesetzliche Transformation in Bundesrecht gilt die GFK völkergewohnheitsrechtlich über Art. 25 GG als generellen Transformator. Art. 31 Abs. 1 GFK ist bislang nicht über das Sekundärrecht umgesetzt worden (vgl. Fischer-Lescano/Horst, a.a.O., S. 82, Fn. 13); so bezieht sich Art. 21 RL 2004/83/EG (Qualifikationsrichtlinie) nur auf den Schutz vor Zurückweisung - non-refoulement - und nicht auf das Pönalisierungsverbot.
Soweit Fischer-Lescano/Horst Art. 31 Abs. 1 GFK ebenso wie Art. 16a GG als Rechtfertigungsgrund sehen und insoweit nach der Strafrechtslehre nicht dogmatisch differenzierend betrachten, wird der Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 GFK nicht ausreichend berücksichtigt. Während Art. 16a GG unbedingt ist, setzt Art. 31 Abs. 1 GFK voraus, dass die vertragschließenden Staaten gegen Flüchtlinge keine Strafen wegen unrechtmäßiger Einreise oder Aufenthalts verhängen dürfen (AG Tiergarten, U. v. 15.04.2011 - 405 Ds 215/10 Jug -, ANA-ZAR 5/2011, S. 37). Die Orientierung an den travaux préparatoires (bei Weis, The Refugee Convention, 1951. The Travaux Préparatoires analyzed, 1995) darf nicht dazu führen, dass über den ausdrücklichen Wortlaut hinaus eine weitergehende Auslegung vorgenommen wird. So darf die Betrachtung der Erwägungsgründe eines Rechtsaktes der EU auch nicht zu einer Tatbestandserweiterung führen, wenn der ausdrückliche Wortlaut der Artikel dies nicht widerspiegelt. Die Annahme einer fluchtspezifischen Notlage i.S. einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr nach § 34 StGB geht tatbestandserweiternd über Art. 31 Abs. 1 GFK hinaus, sobald der Flüchtling den Verfolgerstaat verlassen konnte und einen (beliebigen) sicheren Drittstaat erreicht hat. Ein Strafaufhebungsgrund kann jedoch weiterhin gegeben sein, weil dem Flüchtling aufgrund der Fluchtumstände ein normgerechtes Verhalten nicht zugemutet werden kann. Damit sind - anders als im Falle der direkten Einreise nach Deutschland unter Berufung auf Art. 16a GG - insbesondere die Grenzbehörden ermächtigt (und dem Legalitätsprinzip folgend verpflichtet) Strafanzeigen gegen Flüchtlinge zu erstatten, die aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Denn aufgrund der Fluchtumstände ergeben sich zunächst regelmäßig tatsächliche und zureichende Anhaltspunkte für eine Straftat. Das Strafverfahren selbst ist jedoch auszusetzen, solange das Anerkennungsverfahren als Flüchtling noch nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde.
Grundsätzlich kann sich auf die Strafbefreiung nur berufen, wer unmittelbar aus dem Verfolgerstaat einreist und sich unverzüglich bei den zuständigen Stellen meldet. Unverzüglich bedeutet nach der bisherigen Rechtsprechung ohne schuldhaftes Zögern (BVerfG-K, B. v. 16.6.1987 – 2 BvR 911/85 – NVwZ 1987, 1068; mindestens 2 Tage bis zu einer Woche, vgl. BayObLG NJW 1980, 2030, Lutz InfAuslR, 1997, 384, ggf. länger, wenn dies im Einzelfall aufgrund rechtlicher Beratung nachweislich unabdingbar war). Als Flüchtling kann grds. nur angesehen werden, wer nach dem Ergebnis des Asylverfahren aufgrund der verbindlichen Entscheidung des BAMF als solcher anzusehen ist (§§ 2-4 AsylVfG). Bei versuchter Einreise über einen sicheren Drittstaat wird ihm sowohl die Asylanerkennung (Art. 16 a Abs. 2 GG; § 26 a AsylVfG) als auch die Flüchtlingsanerkennung (§ 60 Abs. 1) versagt (§ 31 Abs. 1 S. 2, 34 a Abs. 1 AsylVfG). Über Letztere wird nur dann entschieden, wenn ihm die Einreise mittels unzutreffender Angaben gegenüber der Grenzbehörde oder unter Umgehung der Grenzkontrollen gelungen ist; dann hat er ggf. aber nicht mehr unverzüglich um Asyl nachgesucht. Erweiternd zu der bisherigen Rechtsprechung muss das Unmittelbarkeitskriterium nach Art. 31 Abs. 1 GFK lediglich verhindern, dass sich auf ein dauerhaftes Recht unbeschränkter Immigration berufen wird. Damit soll bereits ein Ausschluss zeitweiliger Niederlassung (temporarily settled) verhindert werden (so Fischer-Lescano/Horst, a.a.O.).
Streitig ist, ob sich der Strafaufhebungsgrund auch auf die so genannten Begleitdelikte wie z.B. Urkundendelikte erstrecken darf (so AG Frankfurt, StV 1988, S. 306; AG München, StV 1988, S. 306-307; OLG Frankfurt, StV 1997, S. 78-79 in ZAR 3/2011, Fn. 73, 74). Der weiten Auslegung bei Fischer-Lescano/Horst folgend wird über den ausdrücklichen Wortlaut des § 95 Abs. 1 Nr. 1-3 AufenthG hinaus das Tatbestandsmerkmal "unrechtmäßige Einreise/unrechtmäßiger Aufenthalt" aus Art. 31 Abs. 1 GFK zutreffend nach Sinn und Zweck der Vorschrift ausgelegt. Der Tatbestand ist 1957 untechnisch gemeint gewesen und darf nicht im strikten Sinne eines heutigen Strafrechtsnebengesetzes gelesen werden. Das gilt auch für den Fall, wenn sich der Flüchtling eines Fluchthelfers bedient. Die Strafbarkeit von Flüchtlingen steht nicht in einem akzessorischen Verhältnis zu dem Tun etwaiger Fluchthelfer (siehe hierzu sogleich und zum Tatbestand der Einschleusung unter § 96, 97 AufenthG).
13
Der Wortlaut des Art. 31 Abs. 1 GFK schließt nicht explizit aus, dass eine illegale Einreise nicht auch unter Mithilfe von Schleusern geschieht. Die in der Norm genannten Voraussetzungen der Straffreiheit sind insoweit abschließend. Das entspricht den tatsächlichen Gegebenheiten, denn Personen, die vor Verfolgung fliehen, sind meistens nicht in der Lage, die entsprechenden Einreiseformalitäten einzuhalten. Viele von ihnen müssen zur Flucht darüber hinaus die Hilfe Dritter in Anspruch nehmen. Zwar liegt es nicht im Schutzbereich der Norm, kriminellem Tun Vorschub zu leisten. Dieser Gedanke darf aber nicht so weit führen, dem Flüchtling generell den Schutz von Art. 31 GFK zu verwehren, weil er sich Schleusern anvertraut hat.
Nach ständiger Auffassung des UNHCR sollte eine Bestrafung wegen illegaler Einreise auch dann ausgeschlossen sein, wenn der Asylantrag des Asylbewerbers zwar abgelehnt wird, jedoch keine offensichtlich missbräuchliche Asylantragstellung vorliegt. Denn da der Ausgang des Asylverfahrens in der Regel, nicht zuletzt auch wegen der sich ständig ändernden Rechtsprechung und der Auslegungsunterschiede zwischen den verschiedenen europäischen Staaten, für den Asylbewerber nicht vorhersehbar ist, würde andernfalls auch der im guten Glauben handelnde Asylsuchende für eine Tat bestraft, deren Strafbarkeit im Zeitpunkt der Tat für ihn nicht erkennbar ist.
Der Anwendung von Art. 31 Abs. 1 GK steht nicht entgegen, dass der Flüchtling aus einem sicheren Drittstaat nach Deutschland kommt, den er nur als Durchgangsland durchquert hat, sofern dort kein schuldhaft verzögerter Aufenthalt vorgelegen hat (z.B. kein Verlassen des Lkw's des Schleusers möglich). Allerdings sind in einem solchen Fall gesteigerte Anforderungen an die Unverzüglichkeit der Meldung und an die Darlegung der Gründe zu stellen, die die unrechtmäßige Einreise und den unrechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen sollen (OLG Stuttgart, U. v. 02.03.2010 – 4 Ss 1558/09 –; a.A. OLG Köln, U. v. 21.10.2003 – Ss 270/03 – NStZ-RR 2004, 24; OLG Düsseldorf, B. v. 01.07.2008 – III-5 Ss 122/08 – StV 2009, 138; OLG München, B. v. 29.03.2010 – 5St RR (II) 079/10) –, Senge in: Erbs/Kohlhaas, § 95 AufenthG Rn. 70). Aus dem Ziel und Zweck der Vorschrift, Flüchtlingen die Zuflucht in einen schutzbereiten Staat zu ermöglichen, ergibt sich jedoch, dass derjenige, der sich auf Straffreiheit nach Art. 31 Abs. 1 GFK beruft, solange als Flüchtling anzusehen ist, bis das Gegenteil in einem Verfahren zur materiellen Prüfung der Flüchtlingseigenschaft rechtskräftig festgestellt wurde.
III. Täter und Teilnehmer
14
Zum Täterkreis des § 95 können nicht nur Drittausländer (Nichtfreizügigkeitsberechtigte) gehören, sondern auch Deutsche und Unionsbürger bzw. EWR-Bürger (Norwegen, Island, Liechtenstein) sowie Schweizer Staatsbürger (s. u. Rn. 16). Die Anwendbarkeit der Strafnormen ist hier nicht nur mit Blick auf § 2 Abs.1, sondern unter Berücksichtigung von § 11 Abs. 2 FreizügG/EU (Öffnungsklausel anwendbarer Normen aus dem AufenthG), § 12 FreizügG/EU (EWR-Anwendungsbefehl) sowie von völkerrechtlichen Verträgen (Assoziationsrecht) unter dem Aspekt eines integrativen Ansatzes dieses Strafrechtsnebengesetzes differenziert zu beurteilen (vgl. § 1 Abs. 2).
15
Für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland sind EU/EWR-Bürger und ihre Familienangehörigen daher nicht dem allgemeinen Ausländerrecht unterworfen, sondern einem speziellen Gesetz, dem FreizügG/EU, das dem nationalen Ausländerrecht vorgeht (s.o. § 1 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG). Unionsbürger genießen Freizügigkeit nach dem europäischem Gemeinschaftsrecht (= Codifikation des Unionsbürgerrechts: AEUV i.V.m. den sekundärrechtlichen Rechtsakten und der nationalen Umsetzung). Für Schweizer Staatsbürger und deren Familienangehörige gilt das Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz, das als eines von sieben so genannten Sektorenabkommen am 01.06.2002 in Kraft trat. Aufenthaltsrechtlich unterfallen diese Personen primär dem Freizügigkeitsabkommen EG/Schweiz und in Deutschland dem Aufenthaltsgesetz (beachte § 28 AufenthV), soweit die gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen nicht vorgehen.
16
In Bezug auf die Schweiz ist zu beachten, dass die Regelungen zur Familienagehörigeneigenschaft im Artikel 3 des Anhanges I zum Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz niedergelegt sind. Danach sind nur Familienangehörige mit einbezogen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragsstaates besitzen. Angehörige aus Drittstaaten sind im Gegensatz zur RL 2004/38/EG nicht erfasst. Lediglich gem. Artikel 7 Buchst. d des Abkommens ist es den Vertragsstaaten überlassen, die mit der Freizügigkeit zusammenhängenden Rechte der Familienangehörigen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit zu regeln. Die Forderung eines Einreisevisums für diesen Personenkreis, z.B. für Dienstleistungsempfänger (Touristen), ist damit den einzelnen Vertragsstaaten überlassen. Zu beachten sind daher grundsätzlich die Visumpflicht nach Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Anhang I der EUVisumVO für Kurzaufenthalte soweit die Drittstaatsangehörigen nicht ohnehin nach Anhang II visumbefreit sind oder nach Art. 5 Abs. 4 a SGK oder Art. 21 SDÜ Reisefreiheiten in Anspruch nehmen können. Da ungeachtet der Problematik Artikel 3 Abs. 1 S. 3 Anhang I zum Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz vorschreibt, alle Erleichterungen für die Beschaffung der ggf. benötigten Visa zu gewähren, sind den betreffenden Familienangehörigen dritter Staaten notfalls Ausnahmevisa an der Grenze auszustellen. Analog zu der Regelung in der RL 2004/38/EG sollte die Erteilung eines Aufenthaltstitels i.S.d. Freizügigkeitsabkommens durch einen Vertragstaat an Familienangehörige eines Schweizers von der Visumpflicht entbinden.
17
Das Freizügigkeitsabkommen EG-Schweiz enthält selbst keine Sanktionsnormen. Die Anwendung des FreizügG/EU ist nicht zulässig; für Schweizer Bürger und deren drittstaatsangehörigen Familienmitgliedern gilt das Aufenthaltsgesetz. Allerdings sind die Verstöße gegen die Pass- oder Personalausweisbesitz- und Mitführpflicht nach dem AufenthG unter Beachtung des Diskriminierungsverbots nach Art. 2 Freizügigkeitsabkommen anwendbar. Die Straf- und Bußgeldbestimmungen sind daher nur in dem Umfang analog anwendbar, wie sie für Unionsbürger vorgesehen sind (vgl. auch Stoppa, a.a.O., Vorb § 95, Rn. 25 mit Entsprechungstabelle).
18
Für Asylsuchende gelten die Sonderbestimmungen aus Art. 16a GG und die nationalen und europäischen Bestimmungen zum Asylrecht. Die qualifizierten Tatbestände der §§ 96, 97 und die Delikte nach §§ 84, 84a AsylVfG können – ebenso wie die Teilnahme in Bezug auf Anstiftung und Beihilfe gemäß §§ 26, 27 StGB zu allen Delikten – durch Jedermann begangen werden. Beispielsweise sind die Zugehörigkeit zu einem Ausländerverein (Abs. 1 Nr. 8) und falsche Angaben nach Abs. 2 S. 2 auch durch Deutsche möglich (vgl. Aurnhammer, S. 151 f.).
19
Für türkische Staatsangehörige gelten - soweit sie assoziationsberechtigt sind - besondere Bestimmungen (siehe zum Status ausführlich unter OK-MNet-ARB 1/80 und bei Winkelmann, MNet:
![]() Zum völkerrechtlichen Status der Türkei
Zum völkerrechtlichen Status der Türkei
Die Aufenthaltstitel der danach begünstigten Ausländer haben nur deklaratorische Bedeutung, da sich deren Aufenthaltsrecht direkt aus dem ARB 1/80 ergibt. Der Nichtbesitz des Nachweises über das Aufenthaltsrecht führt somit nicht zum unerlaubten Aufenthalt, ist aber gem. § 98 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG ordnungswidrig. Die Einreise darf nicht verweigert werden.
Die Frage, ob überhaupt noch Visumpflicht für türkische Dienstleistungsempfänger nach der Stand-still-Wirkung des Art. 41 Abs. 1 Zusatzprotokoll zum Assoziationsvertrag besteht, kann schuldausschließend sein. Da diese Frage schon von deutschen Juristen nicht eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, kann von einem rechts- und sprachunkundigen türkischen Staatsangehörigen erst recht nicht verlangt werden, dass er die mögliche Strafbarkeit seines Tuns erkennt bzw. erkennen müsste. Es kann daher auch dahinstehen, ob diese Unkenntnis als Tatbestandsirrtum nach § 16 StGB oder als Verbotsirrtum nach § 17 StGB einzustufen ist. Bei einem Tatbestandsirrtum entfiele der Tatvorsatz und eine fahrlässige Begehensweise ist vorliegend nicht strafbar; bei einem Verbotsirrtum entfiele die Schuld, wenn dieser unvermeidbar war (AG Hannover, U. v. 07.01.2011 – 286 Os 7911 Js 100048/10 (123/10) –, juris).
20
Bei Seeleuten auf Schiffen, die berechtigt sind die Bundesflagge zu führen, gilt, dass diese gem. § 4 Abs. 4 AufenthG der Aufenthaltstitelpflicht unterliegen. Jedoch erfasst der Anwendungsbereich der korrespondierenden Strafnorm des § 95 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG lediglich Verstöße „im Bundesgebiet“. Ein außerhalb des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik operierendes Schiff ist völkerrechtlich kein schwimmender Bestandteil des Bundesgebietes, mithin handeln Seeleute unter Verstoß der Aufenthaltstitelpflicht nicht strafbar.
21
Anstiftung und Beihilfe sind nach §§ 27 f StGB strafbar (Aurnhammer, S. 152 f; OLG Frankfurt, U. v. 31.3.1993 – 2 Ss 65/93 – NStZ 1993, 394.). Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist grundsätzlich jede Handlung als Hilfeleistung anzusehen, die die Herbeiführung des Taterfolgs durch den Haupttäter objektiv fördert oder erleichtert; dass sie für den Eintritt des Erfolgs in seinem konkreten Gepräge kausal wird, ist nicht erforderlich (BGH NJW 2007, 384, 388 m.w.N., insoweit in BGHSt 51, 144 nicht abgedruckt; BGH NJW 2008, 1460, 1461). Anders liegt es nur, wenn der Beihilfehandlung jede Eignung zur Förderung der Haupttat fehlt oder sie erkennbar nutzlos für das Gelingen der Tat ist (BGH NJW 2008, 1460, 1461; vgl. auch BGH StV 1996, 87, BGH, B. v. 2.9.2009 – 5 StR 266/09 LG Berlin –). Beihilfe durch Gewährung von Unterkunft und Verpflegung setzt nicht voraus, dass der Haupttäter seinen weiteren Aufenthalt davon abhängig macht (so auch OLG Frankfurt, B. v. 25.02.2005 – NStZ-RR 2005, 184 –; Mosbacher in: Handbuch Arbeitsstrafrecht, 2. Aufl. 2008, Rn. 238 ff.; Senge in: Erbs/Kohlhaas, AufenthG (A 215), Stand 15.07.2009, § 96 Rn. 11, m.w.N.). Denn nach allgemeinen Regeln, die auch beim Dauerdelikt keine Änderung erfahren, muss die Hilfeleistung nicht conditio sine qua non für die Fortsetzung des unerlaubten Aufenthalts sein (BGH ebenda). Beihilfe konnte durch Gewährung von Unterkunft oder Arbeitslohn jedoch bislang ausgeschlossen sein, wenn der Täter zur Fortsetzung seines Tuns unter allen Umständen entschlossen war, der Gehilfe also den illegalen Aufenthalt nicht objektiv förderte oder erleichterte (OLG Karlsruhe, B. v. 14.01.2009 – 2 Ss 53/08 –; KG Berlin, B. v. 09.09.2005 – (3) 1 Ss 229/05 – StV 2006, 585 –; BayObLG, B. v. 19.10.1999 – 4St RR 205/99 – StV 2000, 366 –; BayObLG, B. v. 25.06.2001 – 4St RR 77/01 – NJW 2002, 1663 –; BayObLG, B. v. 21.05.1999 – 4St RR 86/99 – NStZ 1999, 627 –; OLG Düsseldorf, B. v. 31.8.2001 – 2a Ss 149/01 – 46/01 II – EZAR 355 Nr. 28 –; vgl. auch Hailbronner, AuslR, 65. Erg.-Lfg. Aug. 2009, § 95 Rn. 38; Renner, AuslR, 9. Aufl., § 95 Rn. 29). Es ist allerdings eine Tatfrage, ob ein Täter durch solche Leistungen zumindest psychisch unterstützt wird. Abs. 2 erhöht den Strafrahmen für besonders strafwürdig erscheinende Handlungen.
22
Der Täterkreis ergibt sich damit aus der Beschreibung von Tathandlungen und nicht aus einem bestimmten feststehenden Täterbegriff; siehe dazu jeweils unter den einzelnen Strafnormen in diesem Abschnitt.