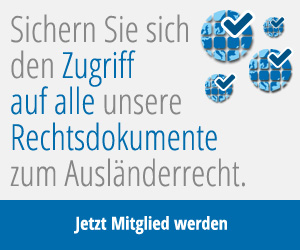B. Rechtsstellung nach Art. 7 (Kommentierung)
- Gesetz:
- Beschluss Nr. 1/80 des Assoziationsrats EWG/Türkei über die Entwicklung der Assoziation vom 19. September 1980
- Paragraph:
- Art. 7 ARB 1/80
- Autor:
- OK-MigNet
- Stand:
- MigNet in: OK-MNet-ARB 1/80 (30.11.-0001)
II. Rechtsstellung
1
Art. 7 privilegiert Familienangehörige eines dem regulären Arbeitsmarkt angehörenden türkischen Arbeitnehmers. Nach dieser Vorschrift haben die Familienangehörigen eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedsstaates angehörenden türkischen Arbeitnehmers, die die Genehmigung erhalten haben, zu ihm zu ziehen, das Recht, sich auf jedes Stellenangebot zu bewerben, wenn sie dort seit mindestens drei Jahren ihren ordnungsgemäßen Wohnsitz haben. Das nach Art. 7 bestehende Recht auf Aufnahme einer Beschäftigung hiernach schließt ein Aufenthaltsrecht ein. Dies gilt auch dann, wenn eine Beschäftigung nicht angestrebt wird.
SächsOVG, B. v. 23.07.2019 – 3 B 174/19, Rn. 9.
Die Rechtstellung eines Familienangehörigen wird durch die Scheidung der Ehe nicht beseitigt. Ist dieses Recht einmal erworben, entfällt es nicht nach Aufhebung der familiären Bande oder dem Wegfall des ordnungsgemäßen Wohnsitzes.
SächsOVG, B. v. 23.07.2019 – 3 B 174/19, Rn. 9.
2
Wegen des Arbeitnehmerbegriffs wird auf Art. 6 I verwiesen. Es ist nicht erforderlich, dass der Arbeitnehmer selbst eine Rechtsposition aus dem ARB 1/80 erlangt hat. Auch dann, wenn der Arbeitnehmer noch nicht die Rechtsstellung nach Art. 6 ARB 1/80 erworben hat, kann er seinen Familienangehörigen die Rechtsstellung nach Art. 7 ARB 1/80 vermitteln. Familienangehörige haben, abgestuft nach der Dauer des ordnungsgemäßen Wohnsitzes im Inland, gem. Art. 7 S. 1 freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Bei Abschluss einer Berufsausbildung im Aufnahmeland steht ihnen unter den Voraussetzungen des Art. 7 S. 2 unabhängig von der eigenen Aufenthaltsdauer der Arbeitsmarkt offen. Art. 6 und 7 sind nebeneinander anwendbar. Art. 7 stellt keine abschließende Spezialregelung für Familienangehörige dar. Sind die Voraussetzungen des Art. 6 I erfüllt, so kann ein Familienangehöriger unabhängig von Art. 7 ein Beschäftigungsrecht und daraus folgend ein Aufenthaltsrecht auch aus Art. 6 erwerben (ebenso Rn. 3.2 AAH-ARB 1/80).
EuGH, U. v. 05.10.1994, Eroglu, C-355/93.
3
Für Art. 7 gelten die vom EuGH zu Art. 6 entwickelten Grundsätze:
EuGH, U. v. 05.10.1994, Eroglu, C-355/93.
- –
- Art. 7 kommt ebenso wie Art. 6 unmittelbare Wirkung zu, sodass ein türkischer Staatsangehöriger, der die Voraussetzungen dieser Vorschrift erfüllt, die Rechte, die sie ihm verleiht, unmittelbar beanspruchen kann,
- –
- das nach Art. 7 bestehende Recht auf Aufnahme einer Beschäftigung impliziert ein Aufenthaltsrecht. Dies gilt auch dann, wenn eine Beschäftigung nicht angestrebt wird (Beschäftigungsoption).
4
Die Tatsache, dass ein türkischer Arbeitnehmer das Aufenthaltsrecht in einem Mitgliedstaat und damit das Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt in diesem Staat als politischer Flüchtling erworben hat, schließt nicht aus, dass ein Angehöriger seiner Familie die Rechte aus Art. 7 S. 1 in Anspruch nehmen kann.
EuGH, U. v. 18.12.2008, Altun, C-337/07, Ls. 2.
5
Bei Art. 7 handelt es sich um einen Daueraufenthaltsstatus.
So BVerwG, U. v. 22.05.2012 – 1 C 6.11. Diese Rechtsansicht wird auch vom BMI geteilt, s. Nr. 4.3.1.3 Verwaltungsvorschrift zum StAG und Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke v. 4.6.2010 (BT-Drs. 17/1927).
Eine Aufenthaltserlaubnis, die ein assoziationsrechtliches Daueraufenthaltsrecht nach Art. 7 S. 1 bescheinigt, muss eine Gültigkeitsdauer von wenigstens fünf Jahren aufweisen.
So BVerwG, U. v. 22.05.2012 – 1 C 6.11.
Außerdem muss sie eindeutig erkennen lassen, dass ihr ein assoziationsrechtliches Daueraufenthaltsrecht zugrunde liegt. Nur mit diesen Angaben können die betroffenen Ausländer im Rechtsverkehr das ihnen zustehende Daueraufenthaltsrecht auf einfache und praxisgerechte Weise dokumentieren.
So BVerwG, U. v. 22.05.2012 – 1 C 6.11.
Auf ein Jahr befristete Aufenthaltstitel, wie sie in der Praxis häufig ausgestellt werden, entsprechen nicht der Rechtsnatur der Rechtsstellung.
6
Verleiht Art. 7 ein unbefristetes Aufenthaltsrecht, ohne dass es einer nationalen Bescheinigung bedarf, so hat dies auch Auswirkungen auf das StAG. Denn nach § 4 III 1 Nr. 2 StAG erwirbt ein nach dem 27.08.2007 im Bundesgebiet geborenes Kind
Wurde das Kind vor dem 28.8.2007 geboren, findet die a.F. des § 4 III StAG Anwendung, die noch verlangte, dass der Elternteil – sofern er nicht Unionsbürger, Schweizer oder EWR-Bürger war – im Besitz einer Niederlassungserlaubnis gewesen ist.
die deutsche Staatsangehörigkeit, sofern ein Elternteil
- –
- seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und
- –
- ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besitzt.
7
Nachdem das BVerwG entschieden hat, dass türkische Staatsangehörige, die im Besitz einer Rechtsstellung nach Art. 7 sind, ein Daueraufenthaltsrecht besitzen[10],
BVerwG, U. v. 22.05.2012 – 1 C 6.11.
können sie ihren Kindern die deutsche Staatsangehörigkeit vermitteln, ohne dass der Besitz einer Niederlassungserlaubnis oder einer Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erforderlich wäre. Voraussetzung ist allein, dass der Elternteil sich seit acht Jahren rechtmäßig im Bundesgebiet aufhält und hier seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Diese Rechtsansicht wird auch vom BMI geteilt, wie sich aus der Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke v. 4.6.2010 (BT-Drs. 17/1927) ergibt.
Wurde die deutsche Staatsangehörigkeit nicht richtig ermittelt, so kann dieser Fehler nachträglich korrigiert werden. Das Bestehen oder Nichtbestehen der deutschen Staatsangehörigkeit kann nach § 30 StAG festgestellt werden. Dies gilt auch in den Fällen des § 4 III StAG. Der Hinweis im Geburtenregister auf den Staatsangehörigkeitserwerb nach § 4 III StAG wird entsprechend berichtigt (§§ 47 und 21 III Nr. 4 PStG). Fristen hierfür sind nicht vorgesehen.
In der Praxis wird es aus folgenden Gründen Probleme bei der Umsetzung geben: Nach § 34 VO zur Ausführung des PStV verlangt das Standesamt bei der Anzeige einer Geburt zur Prüfung der deutschen Staatsangehörigkeit Angaben der Eltern dazu, ob ein unbefristetes Aufenthaltsrecht besteht. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, aber auch wenn Zweifel an der Richtigkeit der Angaben bestehen oder keine Angaben zur Rechtsstellung gemacht werden (§ 34 II PStV), holt das Standesamt durch ein Formblatt (Anlage 12 zu § 34 PStV) Auskunft bei der zuständigen Ausländerbehörde ein, ob die Angaben zutreffen und ob zum Zeitpunkt der Geburt ein unbefristetes Aufenthaltsrecht bzw. ein seit acht Jahren rechtmäßiger gewöhnlicher Aufenthalt im Inland vorlagen. In dem Formblatt bzgl. des Aufenthaltsstatus sind zum Ankreuzen die Möglichkeiten vorgesehen: „Freizügigkeitsberechtigter Unionsbürger, EWR-Staatsangehöriger oder deren Familienangehörige, Niederlassungserlaubnis, Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG, Staatsangehöriger der Schweiz oder dessen Familienangehörige“. Das Aufenthaltsrecht infolge von Art. 6 und 7 fehlt in dieser Auflistung, allenfalls ein Ankreuzen bei „Sonstiges“ oder „unbekannt“ wäre möglich (ausführliche Hinweise).
8
Verliert der türkische Arbeitnehmer seine türkische Staatsangehörigkeit, so führt dies nicht zum Wegfall von bereits erworbenen Rechtsstellungen der Familienangehörigen nach Art. 7 S. 1.
OVG RhPf, B. v. 29.06.2009 – 7 B 10454/09;
VG Freiburg, U. v. 19.01.2010 – 3 K 2399/08.
Denn der EuGH hat mehrmals klargestellt, dass die Rechtsstellung der Familienangehörigen nach Erwerb der Rechtsstellung nur noch unter zwei Voraussetzungen entfallen kann: Entweder stellt die Anwesenheit des türkischen Wanderarbeitnehmers im Hoheitsgebiet des Aufnahmemitgliedstaates wegen seines persönlichen Verhaltens eine tatsächliche und schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit i.S.v. Art. 14 I dar oder der Betroffene hat das Hoheitsgebiet des Staates für einen nicht unerheblichen Zeitraum ohne berechtigte Gründe verlassen. Dabei ist grundsätzlich vom abschließenden Charakter der beiden genannten Verlustgründe auszugehen.
Vgl. BVerwG, U. v. 30.04.2009 – 1 C 6.08, m.w.Nw.;
EuGH, U. v. 21.10.2020, GR, C-720/19, Rn 25;
EuGH, U. v. 25.09.2008, Hakan Er, C-453/07.
Rechte nach Art. 7 S. 1 sind daher vom Fortbestehen der Voraussetzungen für ihre Entstehung unabhängig.
EuGH, U. v. 21.10.2020, GR, C-720/19, Rn 23.
Der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch einen Familienangehörigen stellt selbst dann, wenn er dem Betroffenen Rechte verleiht, die weiter gehen als die durch den Beschluss Nr. 1/80 gewährten, keinen Umstand dar, der zum Verlust von Rechten führen kann, die der Betroffene zuvor gemäß Art. 7 S. 1 erworben hat.
EuGH, U. v. 21.10.2020, GR, C-720/19, Rn 23.
9
Hiervon zu unterscheiden ist der Fall, dass während der Erwerbsphase der Rechtsstellung nach Art. 7 S. 1 von dem Arbeitnehmer die deutsche Staatsangehörigkeit erworben wird. Tritt diese im Wege der doppelten Staatsangehörigkeit neben die deutsche Staatsangehörigkeit, so kann der Familienangehörige weiterhin Rechte von dem türkischen Arbeitnehmer ableiten. Insoweit hat der EuGH in den Rechtssache Kahveci und Inan entschieden, dass Art. 7 dahin gehend auszulegen ist, dass die Familienangehörigen eines türkischen Arbeitnehmers, der dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaats angehört, sich weiterhin auf diese Bestimmung berufen können, wenn dieser Arbeitnehmer die Staatsangehörigkeit des Aufnahmemitgliedstaats erhalten hat und gleichzeitig die türkische Staatsangehörigkeit beibehält.
EuGH, U. v. 29.03.2012, Kahveci und Inan, C-7/10 und C-9/10.
10
Gibt der türkische Arbeitnehmer hingegen während der Erwerbsphase seine bisherige Staatsangehörigkeit auf, so kann er die Rechte aus Art. 7 S. 1 nicht mehr an seine Familienangehörigen vermitteln.
Vgl. OVG RhPf, B. v. 29.06.2009 – 7 B 10454/09;
HessVGH, B. v. 23.07.2007 – 11 ZU 601/07, InfAuslR 2008, 7;
vgl. auch EuGH, U. v. 11.11.1999, Mesbah, C-179/98, zum Kooperationsabkommen mit Marokko, wonach sich der Familienangehörige eines marokkanischen Wanderarbeitnehmers, der die Staatsangehörigkeit des Aufnahmemitgliedstaates erwirbt, bevor der Familienangehörige beginnt, mit ihm in dem betreffenden Mitgliedstaat zusammenzuleben, nicht auf das Abkommen berufen kann.
Mit dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit bedarf der Betreffende weder eines Beschäftigungs- noch eines davon abhängigen Aufenthaltsrechts nach dem ARB 1/80. Wegen des Erwerbs des Inländerstatus und des Verlusts der türkischen Staatsangehörigkeit kann er für seinen Aufenthalt in Deutschland keine Rechte mehr aus dem Assoziierungsabkommen herleiten, denn Art. 7 dient der Integration der Familienangehörigen im Mitgliedstaat.
VG Freiburg, U. v. 19.01.2010 – 3 K 2399/08 unter Hinweis auf BVerwG, U. v. 30.04.2009 – 1 C 6.08.
Beide Zwecke haben sich aber mit dem Erwerb der deutschen und dem gleichzeitigen Verlust der türkischen Staatsangehörigkeit erledigt. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, dass die Betroffenen die türkische bzw. die ausländische Staatsangehörigkeit wieder erwerben und dadurch die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren könnten und dann wieder auf die Rechtsstellung aus dem Assoziationsratsbeschluss angewiesen sein könnten. Denn die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband ist auf Dauer angelegt und hat grundsätzlich eine Entlassung aus der früheren Staatsangehörigkeit zur Voraussetzung, mit allen aus dem Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit erwachsenden günstigen sowie aus dem Verlust der türkischen bzw. ausländischen Staatsangehörigkeit sich ergebenden negativen Folgen für die Betroffenen.
VG Freiburg U. v. 19.01.2010 – 3 K 2399/08.
Dazu zählt auch der Verlust der Rechtsstellung aus dem Assoziationsratsbeschluss.
11
Es stellt jedoch eine ungeklärte unionsrechtliche Rechtsfrage dar, ob im Fall einer unterlassenen Optionserklärung nach § 29 II StAG in der bis 19.12.2014 geltenden Fassung eine infolge des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit verlorene Rechtsstellung nach Art. 7 S. 1 ARB 1/80 wieder auflebt.
VGH BW, B. v. 23.08.2016 – 11 S 1225/16, Rn. 5.
Die mit der besonderen Rechtsstellung verfolgte Integration des Familienmitglieds wird mit der Einbürgerung vollendet.
Vgl. VGH BW, B. v. 23.08.2016 – 11 S 1225/16, Rn. 5, unter Hinweis auf EuGH, U. v. 15.01.2015, Demirci, C-171/13.
Diese Sichtweise ist aber nur dann ohne Weiteres konsequent und schlüssig, wenn die Einbürgerung auf Dauer angelegt ist,
So Vgl. VGH BW, B. v. 23.08.2016 – 11 S 1225/16, Rn. 5;
vgl. auch VG Freiburg U. v. 19.02010 – 3 K 2399/08,
auch wenn sicherlich ein späterer Verlust, etwa im Falle des Erwerbs einer anderen Staatsangehörigkeit (vgl. etwa § 25 StAG), eintreten kann; dies ändert aber nichts daran, dass die Einbürgerung zunächst auf Dauer angelegt ist. Ist diese aber, wie hier, nur auflösend bedingt durch die unterlassene Abgabe einer entsprechenden Erklärung bis zur Vollendung des 23. Lebensjahrs, so drängt sich die Frage auf, ob der unwiederbringliche Verlust der assoziationsrechtlichen Rechtsstellung noch mit deren Geltungsgrund zu vereinbaren ist; dies gilt umso mehr, wenn der Erwerb der auflösend bedingten deutschen Staatsangehörigkeit nach § 4 I StAG kraft Gesetzes erfolgt. Aus der bisherigen Rechtsprechung des EuGH lassen sich keine eindeutigen Aussagen entnehmen, die einen hinreichenden sicheren Schluss in die eine oder andere Richtung zulassen. Der VGH BW neigt allerdings zu der Sichtweise, dass ausgehend von den mit Art. 7 ARB 1/80 verfolgten Zielen und Zwecke mehr dafür spricht, von einem Wiederaufleben der Rechtsstellung auszugehen.
VGH BW, B. v. 23.08.2016 – 11 S 1225/16, Rn. 5.
> nach oben
> zurück zu Art. 7 und der Gliederung seiner Kommentierung
> weiter