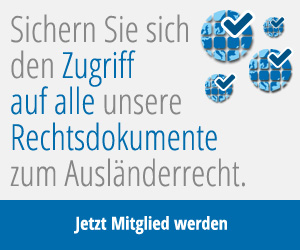A. Art. 21 AEUV (Kommentierung)
- Gesetz:
- Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU)
- Paragraph:
- § 12a Unionsrechtliches Aufenthaltsrecht
- Autor:
- OK-MNet
- Stand:
- MNet in: OK-MNet-FreizügG/EU (07.08.2024)
Inhaltsverzeichnis
I. Nachhaltiges Gebrauchmachen
II. Aufenthaltsrechtliche Umsetzung
I. Nachhaltiges Gebrauchmachen
Nach Art. 21 Abs. 1 AEUV hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten. Von diesem Recht wird im Sinne von § 12a FreizügG/EU nachhaltig Gebrauch gemacht, wenn ein Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat von einer gewissen Dauer vorliegt.
Der Wortlaut des § 12a FreizügG/EU lässt allein die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit nicht ausreichen, vielmehr muss von ihm nachhaltig Gebrauch gemacht werden. Das Adjektiv „nachhaltig“ weist darauf hin, dass eine Handlung längere Zeit anhaltend wirkt; dies verlangt eine gewisse Zeitdauer des Aufenthalts in dem anderen Mitgliedstaat.
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 80
Diese Annahme wird durch die Historie und Gesetzesbegründung bestätigt. Die Formulierung „nachhaltig Gebrauchmachen“ entstammt der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu den sogenannten „Dänemark-Ehen“ (vgl. BVerwG, Urteile vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, juris Rn. 10 ff., und vom 16.11.2010 - 1 C 17.09 -, juris Rn. 9 ff.; vgl. zu Belgien auch BVerwG, Urteil vom 22.06.2011 - 1 C 11.10 -, juris Rn. 7 ff.) und soll verdeutlichen, dass nicht jedwede Art des Gebrauchmachens der Freizügigkeitsrechte - etwa als Urlauber - ausreicht, um den Anwendungsbereich der „Familienfreizügigkeit“ zu eröffnen. Im Fall der sogenannten „Dänemark-Ehe“ reisen der drittstaatsangehörige Ausländer, der einen Aufenthaltstitel zum Zweck des Ehegattennachzugs begehrt, und der deutsche Partner für eine Kurzreise nach Dänemark, um dort zu heiraten (vgl. BVerwG, Urteile vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, juris Rn. 3 f., und vom 16.11.2010 - 1 C 17.09 -, juris Rn. 2). Das Bundesverwaltungsgericht hat ausgeführt, dass für eine „Mitnahme“ des Freizügigkeitsstatus in den Heimatstaat und eine entsprechende Begünstigung des drittstaatsangehörigen Ehegatten erforderlich ist, dass der Unionsbürger mit einer gewissen Nachhaltigkeit von seiner Freizügigkeit Gebrauch macht (vgl. Urteil vom 16.11.2010 - 1C 17.09 -, juris Rn. 9 ff.). Würde bereits jeder kurzfristige, von vornherein nicht auf eine gewisse Dauer angelegte Aufenthalt eines Unionsbürgers in einem anderen Mitgliedstaat - etwa zu touristischen Zwecken - für einen unionsrechtlich begründeten Nachzugsanspruch des mitreisenden drittstaatsangehörigen Ehegatten bei Rückkehr in den Heimatstaat ausreichen, liefe das Recht der Mitgliedstaaten zur Regelung von Einreise und Aufenthalt für den einem Drittstaat angehörenden Ehegatten oder sonstige Familienangehörige ihrer eigenen Staatsbürger weitgehend leer (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, juris Rn. 13). Dieses Recht der Mitgliedstaaten hat der Gerichtshof der Europäischen Union in seinen Entscheidungen immer wieder ausdrücklich anerkannt und betont, dass die Vertragsbestimmungen über die Freizügigkeit nicht auf Tätigkeiten anwendbar sind, die mit keinem relevanten Element über die Grenzen eines Mitgliedstaats hinausweisen (vgl. EuGH, Urteile vom 25.07.2008 - C-127/08 - Metock, juris Rn. 77, und vom 01.04.2008 - C-212/06 - Gouvernement de la Communauté française u.a., juris Rn. 39 m.w.N.; BVerwG, Urteil vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, juris Rn. 13). Das Bundesverwaltungsgericht geht daher davon aus, dass der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den sogenannten Rückkehrerfällen eine Art Bagatellvorbehalt dergestalt entnommen werden kann, dass - angesichts der erheblichen Rechtsfolgen des Gebrauchmachens von der Freizügigkeit im Rückkehrfall - auch dieses Gebrauchmachen selbst von einer gewissen Erheblichkeit bzw. Nachhaltigkeit sein muss (vgl. BVerwG, Urteil vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, juris Rn. 13).
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 81
Nach der Gesetzesbegründung wurden die Regelungen in § 1 Abs. 1 Nr. 6 und § 12a FreizügG/EU über die entsprechende Geltung des Freizügigkeitsgesetzes/EU auch für Familienangehörige und nahestehende Personen von Deutschen, die von ihrem Recht auf Freizügigkeit nach Art. 21 AEUV nachhaltig Gebrauch gemacht haben, ferner zur Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Freizügigkeitsrechten aus Art. 21 AEUV eingeführt (vgl. Bundestagsdrucksache 19/21750, S. 35 und S. 48). Dies betraf insbesondere die Urteile vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B., und vom 14.11.2017 - C-165/16 - Lounes. Hintergrund ist nach der Gesetzesbegründung jeweils die Überlegung des Gerichtshofs der Europäischen Union, dass die Ausübung des Freizügigkeitsrechts durch einen Unionsbürger in Fällen, in denen er es gemeinsam mit seinen drittstaatsangehörigen Familienangehörigen und nahestehenden Personen ausübt, nicht dazu führen soll, dass er befürchten muss, bei einer Rückübersiedlung oder einer Aufenthaltsverlagerung in seinen Herkunftsmitgliedstaat dort nicht mehr weiter mit ihnen zusammenleben zu können, weil die Familienangehörigen und nahestehenden Personen dort nur unter engeren Voraussetzungen als zuvor im anderen Mitgliedstaat ein Aufenthaltsrecht erhalten würden (vgl. Bundestagsdrucksache 19/21750, S. 35). Zu den sogenannten Rückkehrerfällen, denen das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B. zuzuordnen ist, führt die Gesetzesbegründung aus: Diese Fallgruppe „umfasst Familienangehörige und nahestehende Personen von Deutschen, die ein Freizügigkeitsrecht aus einem gemeinsamen Aufenthalt mit dem Deutschen in einem anderen Mitgliedstaat erworben haben, weil ein Deutscher, von dem sie ihr Recht auf Freizügigkeit ableiten, nach Art. 21 AEUV von seinem eigenen Freizügigkeitsrecht in dem anderen Mitgliedstaat nachhaltig Gebrauch gemacht hat oder von seinem Freizügigkeitsrecht durch einen Umzug nach Deutschland Gebrauch macht.“
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 82
Mit der Auslegung, dass ein „nachhaltiges Gebrauchmachen“ eine gewisse zeitliche Dauer erfordert, werden Sinn und Zweck des § 12a FreizügG/EU, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Freizügigkeitsrechten aus Art. 21 AEUV in die nationale Gesetzgebung zu übernehmen, nicht verfehlt. Denn diese Auslegung steht entgegen der Ansicht des Klägers mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu Art. 21 AEUV in Einklang.
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 83
Allein aus dem Wortlaut des § 12a FreizügG/EU ergibt sich kein Widerspruch zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union, da in dessen Entscheidungen in der deutschen Übersetzung neben der häufigeren Formulierung „Ausübung des Freizügigkeitsrechts“ ohne Unterscheidung auch die Formulierung „Gebrauch machen“ verwendet wird (vgl. EuGH, Urteil vom 14.11.2017 - C-165/16 - Lounes, juris Rn. 51: Gebrauchmachen und Rn. 57: Ausübung). In der englischen Sprachfassung wird in diesen Fällen insoweit gar nicht differenziert (vgl. EuGH, Urteil vom 14.11.2017 - C-165/16 - Lounes, juris Rn. 51: „exercised her freedom to move and reside in a Member State other than her Member State of origin“ und Rn. 57: „in the exercise of their freedom of movement“).
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 84
Die Regelung des § 12a FreizügG/EU wird ferner zu Recht auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zu den sogenannten Rückkehrerfällen gestützt. Dort heißt es, für die Annahme eines aus Art. 21 AEUV abgeleiteten Aufenthaltsrechts sei es erforderlich, dass der Unionsbürger sein Freizügigkeitsrecht ausgeübt hat, indem er sich in einem anderen Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, niedergelassen hat (vgl. EuGH, Urteile vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B., juris Rn. 39, 50 ff., vom 10.05.2017 - C-133/15 - Chavez-Vilchez, juris Rn. 52, 54, und vom 27.06.2018 - C-230/17 - Altiner und Ravn, juris Rn. 30). Niederlassen verlangt nicht nur einen kurzfristigen grenzüberschreitenden Bezug, sondern einen Aufenthalt im Aufnahmemitgliedstaat, der auf eine gewisse Dauer angelegt ist (vgl. EuGH, Urteil vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B., juris Rn. 39 und 57). Ein Unionsbürger, der lediglich seine Rechte aus Art. 6 Abs. 1 Richtlinie 2004/38/EG ausübt (Aufenthalt bis zu drei Monaten), will sich im Aufnahmemitgliedstaat nicht auf eine Weise niederlassen, die der Entwicklung oder Festigung eines Familienlebens in diesem Mitgliedstaat förderlich ist (vgl. EuGH, Urteil vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B., juris Rn. 52). Nur ein Aufenthalt, der die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 und 2 Richtlinie 2004/38/EG oder Art. 16 Richtlinie 2004/38/EG erfüllt, deren Aufenthalt somit auf eine gewisse Dauer angelegt war, kann dem Drittstaatsangehörigen ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht eröffnen. Kurzaufenthalte an Wochenenden oder in den Ferien in einem anderen Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitzt, fallen - auch zusammen betrachtet - unter Art. 6 Richtlinie 2004/38/EG und erfüllen nicht die genannten Voraussetzungen (vgl. EuGH, Urteil vom 12.03.2014 - C-456/12 - O. und B., juris Rn. 57, 59; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 20.01.2022 - 11 S 2757/20 -, juris Rn. 60).
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 85
Eine feste zeitliche Grenze, ab wann von einer Nachhaltigkeit auszugehen ist, gibt es nicht. Der Gesetzgeber geht davon aus, dass das „nachhaltige Gebrauchmachen“ in der Fallgruppe der Rückkehrerfälle eine Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat erfordert, die über die Dauer einer Kurzreise oder einer nur formalen Wohnsitznahme hinausgeht.
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 90
Zeitlich hält der Gesetzgeber mindestens einen Aufenthalt von drei Monaten für erforderlich.
vgl. BT-Drs. 19/21750, S. 35 f.
Das Bundesverwaltungsgericht hat in den „Dänemark-Fällen“ bislang offen gelassen, wo im Einzelnen die Grenze zu ziehen ist, von der an das Gebrauchmachen von den unionsrechtlichen Freizügigkeits- und Aufenthaltsrechten in einem anderen Mitgliedstaat als ausreichend nachhaltig angesehen werden kann, um bei Rückkehr in den Heimatstaat ein unionsrechtlich begründetes Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Ehegatten zu rechtfertigen, und ob eine verallgemeinerungsfähige Konkretisierung insoweit überhaupt möglich ist.
BVerwG, Urteile vom 22.06.2011 - 1 C 11.10 -, Rn. 9, vom 11.01.2011 - 1 C 23.09 -, uris Rn. 14, und vom 16.11.2010 - 1 C 17.09 -, juis Rn. 13
Unter Berücksichtigung wertender Gesichtspunkte wird es aus Gründen des effet utile keine feste zeitliche Grenze geben können. Anhaltspunkte für einen nachhaltigen Gebrauch des Freizügigkeitsrechts aus Art. 21 AEUV kann ein Aufenthalt von mehr als drei Monaten liefern. Diese zeitliche Grenze beruht auf der Unterscheidung von Kurzaufenthalten bis zu drei Monaten in Art. 6 der Richtlinie 2004/38/EG, für die der Unionsbürger nur im Besitz eines Personalausweises oder Reisepasses sein muss, und Aufenthalten für mehr als drei Monate nach Art. 7 der Richtlinie 2004/38/EG, bei denen weitere Voraussetzungen zu erfüllen sind.
VGH BW, Urteil vom 5. Juli 2023 – 12 S 1835/21 –, Rn. 90
II. Aufenthaltsrechtliche Umsetzung
Ein unmittelbar aus Art. 21 Abs. 1 AEUV hergeleitetes Aufenthaltsrecht für Familienangehörige eines Unionsbürgers vermittelt nicht nur ein Recht auf Einreise, Aufenthalt und Wohnsitznahme, sondern ein Freizügigkeitsrecht im Sinne des § 2 Abs. 1 FreizügG/EU.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 19
Diesem Freizügigkeitsrecht ist durch Ausstellung einer Aufenthaltskarte nach § 5 FreizügG/EU Rechnung zu tragen.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 14
Denn auf ein unmittelbar aus Art. 21 Abs. 1 AEUV hergeleitetes Aufenthaltsrecht für drittstaatsangehörige Familienangehörige von Unionsbürgern ist die UnionbürgerRL entsprechend anwendbar.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 24
Anders als ein aus Art. 20 AEUV resultierendes Aufenthaltsrecht, das nur "ausnahmsweise" oder bei "Vorliegen ganz besondere(r) Sachverhalte" besteht
BVerwG, Urteil v. 12.07.2018 – 1 C 16.17 – Rn. 34 m.w.N. zur Rspr. des EuGH
und gegenüber dem Recht aus Art. 21 AEUV nachrangig ist
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 24
EuGH, Urteil vom 10. Mai 2017 - C-133/15, - Rn. 56 f.
handelt es sich bei dem aus Art. 21 Abs. 1 AEUV abgeleiteten Freizügigkeitsrecht um ein vollwertiges und eigenständiges Recht, in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einzureisen und sich dort aufzuhalten.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 24
Es wird unabhängig von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder dergleichen seitens des Aufnahmestaats unmittelbar Kraft primären Unionsrechts oder, je nach Sachlage, durch die zu dessen Umsetzung ergangenen Bestimmungen erworben.
EuGH, Urteil vom 8. April 1976 - C-48/75 [ECLI:EU:C:1976:57], Royer - Rn. 31 ff.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 24
Gemäß Art. 21 Abs. 1 AEUV hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in den Verträgen und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 19
Unionsbürger ist gemäß Art. 20 Abs. 1 Satz 2 AEUV, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Der Unionsbürgerstatus ist dazu bestimmt, der grundlegende Status der Angehörigen der Mitgliedstaaten zu sein (stRspr, vgl. EuGH, Urteil vom 20. September 2001 - C-184/99 [ECLI:EU:C:2001:458], Grzelczyk - Rn. 30 f.). Das Recht des Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats einzureisen und sich dort aufzuhalten, wird jedem, der unter den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt, unabhängig von der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis oder dergleichen seitens des Aufnahmestaats unmittelbar im primären Unionsrecht oder, je nach Sachlage, in den zu dessen Umsetzung ergangenen Bestimmungen gewährt (EuGH, Urteil vom 8. April 1976 - C-48/75 [ECLI:EU:C:1976:57], Royer - Rn. 31 ff.).
BVerwG, U. v. 21.09.2019 – 1 C 48/18 – Rn. 28
Das allgemeine Einreise- und Aufenthaltsrecht aller Unionsbürger im Sinne des Art. 21 Abs. 1 AEUV erfährt in Bezug auf die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Art. 45 AEUV eine spezifische (EuGH, Urteil vom 12. März 2014 - C-457/12 [ECLI:EU:C:2014:136], S. und G. - Rn. 45) und spezielle (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juli 2017 - C-566/15 [ECLI:EU:C:2017:562], Erzberger - Rn. 25) Ausprägung, die zugleich einen der fundamentalen Grundsätze der Union verkörpert (stRspr, vgl. EuGH, Urteil vom 15. Dezember 1995 - C-415/93 [ECLI:EU:C:1995:463], Bosman - Rn. 93). Gemäß Art. 45 Abs. 1 AEUV ist innerhalb der Union die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet. Nach Art. 45 Abs. 3 Buchst. b und c AEUV gibt die Freizügigkeit - vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen - den Arbeitnehmern das Recht, sich zum Zweck der Bewerbung auf tatsächlich angebotene Stellen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben.
BVerwG, U. v. 21.09.2019 – 1 C 48/18 – Rn. 28
Als Grundrecht der Arbeitnehmer und ihrer Familien (EuGH, Urteil vom 13. Juli 1983 - C-152/82 [ECLI:EU:C:1983:205], Forcheri und Marino - Rn. 11) ist die Arbeitnehmerfreizügigkeit nicht in einem engen Sinne zu verstehen. Die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 dient ebenso wie die ihr vorausgehende Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft (ABl. L 257 S. 2) dazu, die Verwirklichung der Ziele der Arbeitnehmerfreizügigkeit zu erleichtern (EuGH, Urteil vom 13. Februar 1985 - C-267/83 [ECLI:EU:C:1985:67], Diatta - Rn. 15).
BVerwG, U. v. 21.09.2019 – 1 C 48/18 – Rn. 28
Sie formt den Inhalt des Grundsatzes der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, wie er in Art. 45 AEUV niedergelegt ist, auch in Bezug auf deren Familienangehörige aus und ist im Lichte des von Art. 8 EMRK gewährleisteten Anspruchs auf Achtung des Familienlebens auszulegen (EuGH, Urteil vom 18. Mai 1989 - C-249/86 [ECLI:EU:C:1989:204], Kommission/Bundesrepublik Deutschland - Rn. 10). Gemäß Erwägungsgrund 4 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 ist die Freizügigkeit ein Grundrecht nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch ihrer Familien. Damit das Recht auf Freizügigkeit nach objektiven Maßstäben in Freiheit und Menschenwürde wahrgenommen werden kann, müssen ausweislich des Halbsatzes 2 des Erwägungsgrundes 6 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 alle Hindernisse beseitigt werden, die sich der Mobilität der Arbeitnehmer entgegenstellen, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen für die Integration der Familie des Arbeitnehmers im Aufnahmeland. Dies macht es erforderlich, die bestmöglichen Bedingungen für die Integration der Familie des Wanderarbeitnehmers im Aufnahmemitgliedstaat zu schaffen (EuGH, Urteil vom 13. Juni 2013 - C-45/12 - Rn. 44 ff.). In diesem Sinn bezweckt die Verordnung (EU) Nr. 492/2011 nicht nur die Verwirklichung der Freizügigkeit der Wanderarbeitnehmer, sondern vermittelt sie Freizügigkeit auch deren Familienangehörigen.
BVerwG, U. v. 21.09.2019 – 1 C 48/18 – Rn. 28
Nach Auffassung des BVerwG schützt Art. 21 AEUV das Recht der Unionsbürger auf Freizügigkeit und vermittelt nach der Rechtsprechung des EuGH Familienangehörigen eines freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgers auch in bestimmten Fallkonstellationen, die nicht unmittelbar von der Richtlinie 2004/38/EG (sog. Unionsbürgerrichtlinie) erfasst werden, ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 19
In Art. 21 Abs. 1 AEUV ist die Freizügigkeit der Unionsbürger primärrechtlich verankert, die auch das Recht umfasst, im Aufnahmemitgliedstaat ein normales Familienleben zu führen. Dieses Aufenthaltsrecht steht auf einer Stufe mit den Freizügigkeitsrechten aus der Richtlinie 2004/38/EG. In Fällen, in denen drittstaatsangehörigen Familienangehörigen eines Unionsbürgers zwar aus der Richtlinie 2004/38/EG kein Recht auf Aufenthalt zusteht, sie aber dennoch auf der Grundlage des Art. 21 Abs. 1 AEUV "ein solches Aufenthaltsrecht" herleiten können, darf dies in den Voraussetzungen für die Gewährung nicht strenger sein als das Aufenthaltsrecht nach der Richtlinie 2004/38/EG, die darauf anzuwenden ist.
BVerwG, Urteil v. 23.09.2020 – 1 C 27/19 – Rn. 19
EuGH, Urteile vom 12. März 2014 - C-456/12, O. und B. - Rn. 50 und 61
EuGH, Urteil v. 14. November 2017 - C-165/16 [ECLI:EU:C:2017:862], Lounes - Rn. 45 und 61).
Berufe sich ein Drittstaatsangehöriger auf ein aus der Freizügigkeitsgarantie für Unionsbürger nach Art. 21 AEUV abgeleitetes Aufenthaltsrecht zur Führung eines normalen Familienlebens in einem anderen EU-Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsangehörigkeit der Unionsbürger besitze, müsse die Referenzperson, von der er das Recht ableite (hier das Kind) im Aufnahmemitgliedstaat aus eigenem Recht freizügigkeitsberechtigt sein; ein lediglich vom anderen Elternteil (hier der Mutter) abgeleitetes Freizügigkeitsrecht des Kindes reiche hierfür nicht. Ein eigenes Aufenthaltsrecht des Kindes bestehe nur, wenn u.a. ausreichende Existenzmittel zur Verfügung stünden (Art. 7 Abs. 1 Buchst. b Unionsbürgerrichtlinie).
Außerdem müsse der drittstaatsangehörige Elternteil nach der Rechtsprechung des EuGH in dieser Fallkonstellation für ein aus Art. 21 AEUV abgeleitetes Aufenthaltsrecht auch tatsächlich für das Kind sorgen. Die hierzu erforderlichen Feststellungen seien vom Verwaltungsgerichtshof im zurückverwiesenen Verfahren zu treffen. Ein unmittelbar aus Art. 21 AEUV abgeleitetes Aufenthaltsrecht des drittstaatsangehörigen Familienangehörigen sei ein unionsrechtliches Freizügigkeitsrecht, dem die Möglichkeit der Erteilung eines nationalen Aufenthaltstitels nicht entgegenstehe.
Eine entsprechende Anwendung des Freizügigkeitsrechtes auf Familienangehörige kommt nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 19. Oktober 2004 – C-200/02 – „Zhou und Chen“ auch in Betracht, wenn ein Kind neben der Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaates, in dem es geboren wurde, die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates besitzt, bisher aber noch nicht von einem Mitgliedstaat in den anderen gereist ist.