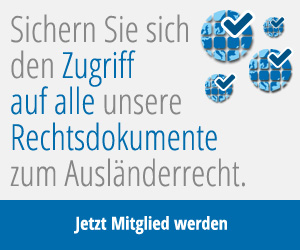Der vorliegende Entwurf eines Gesetzes zur Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten (BT-Drs. 21/321) soll Zuwanderung in die Bundesrepublik Deutschland begrenzen. Der Gesetzentwurf zielt auf eine Verringerung der Belastungen der Länder und Kommunen durch die Verringerung der Aufnahme von Familienangehörigen subsidiär Schutzberechtigter ab. Das soll durch eine zeitweise Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten erreicht werden. Deren Zahl wird durch die Aussetzung des Familiennachzugs um bis zu 12.000 jährlich verringert.
Der Gesetzgeber hatte erst mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung vom 27.7.2015 (Familiennachzugsneuregelungsgesetz vom 12.7.2018 [BGBl. I 1147]) den Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten mit dem Nachzug zu GFK-Flüchtlingen gleichgestellt. Tragender Grund dieser Gleichstellung war der Umstand, dass auch bei subsidiär Schutzberechtigten und ihren Angehörigen „eine Herstellung der Familieneinheit im Herkunftsstaat nicht möglich ist“ (BT-Drs. 18/4097, 46).
Durch das am 17.3.2016 in Kraft getretene Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren („Asylpaket II“ - BGBl. I 390) wurde der Familiennachzug für Familienangehörige von Ausländern im Bundesgebiet, die gemäß § 25 Abs. 2 S. 1 Alt. 2 subsidiären Schutz nach § 4 Abs. 1 AsylG genießen, erstmals ausgesetzt (§ 104 Abs. 13 AufenthG). Die Aussetzung des Familiennachzugs, die am 14.7.2016 endete, wurde nochmals durch Gesetz zur Verlängerung der Aussetzung des Familiennachzugs zu subsidiär Schutzberechtigten vom 16.3.2018 bis zum 1.8.2018 verlängert, um ausreichend Zeit für die gesetzliche Regelung gem. § 36a zu erhalten. Damit kehrte der Gesetzgeber nach Ablauf der zweijährigen Wartezeit – entgegen der ursprünglichen Absicht – nicht zur der bis zum 17.3.2016 geltenden großzügigen Nachzugsregelung zurück.
Mit dem zum 1.8.2018 in Kraft getretenen Familiennachzugsneuregelungsgesetz wurde § 36a eingeführt, um den Kapazitäten von Aufnahme- und Integrationssystemen bei einer gleichzeitigen angemessenen Berücksichtigung der ehelichen und familiären Bindungen Rechnung zu tragen. Der Gesetzgeber ging damals davon aus, dass die verfassungsrechtlich geschützten Rechtsgüter von Ehe und Familie auf der einen Seite und die Integrations- und Aufnahmefähigkeit des Staates und der Gesellschaft sowie das daraus folgende legitime Interesse an einem gesteuerten und geordneten Zuzug von Ausländern auf der anderen Seite in Rahmen der Entscheidung über den Familiennachzug zu berücksichtigen sind. Der Aufnahmefähigkeit wurde dadurch Rechnung getragen, dass der Nachzug nach § 36a Abs. 2 S. 2 monatlich auf 1.000 Familienangehörige von subsidiär Schutzberechtigten beschränkt wurde.
Mit der beabsichtigten Neuregelung kehrt der Gesetzgeber daher nur an die vormalige Regelung im „Asylpaket II“ zurück und setzt den Familiennachzug nochmals für die Dauer von zwei Jahren aus.
In Anbetracht der Gesetzgebungshistorie kann daher festgestellt werden, dass der ungeregelte Familiennachzug zu subsidiär Schutzberechtigten eine Ausnahme bildet, die nur wenige Jahre in Kraft war.
In der Diskussion wird nun häufig behauptet, dass die geplante Neuregelung gegen Unions-, Verfassungs- und Völkerrecht verstoße. Dies ist ersichtlich nicht der Fall.
Die Regelung ist mit Art. 8 EMRK vereinbar. Der EGMR erkennt an, dass es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern zu kontrollieren und zu regeln. Er hat wiederholt entschieden, dass Art. 8 EMRK nicht so ausgelegt werden kann, dass sich aus Art. 8 EMRK im Bereich der Einwanderung eine generelle Verpflichtung eines Staates ergibt, die Wahl des ehelichen Wohnsitzes eines verheirateten Paares zu respektieren oder eine Familienzusammenführung auf seinem Gebiet zu gestatten. Aus der EMRK kann daher kein Recht abgeleitet werden, sein Familienleben in einem Staat nach freier Wahl herzustellen.
Der EGMR hat bislang nur ausnahmsweise ein Recht auf Einreise für einzelne Familienangehörige angenommen, um das Zusammenleben der Familie gerade im betroffenen Mitgliedstaat zu ermöglichen. In der Rechtssache Jeunesse gegen die Niederlande folgerte der EGMR aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Familiennachzug aufgrund außergewöhnlicher Faktoren. So hielt sich die Klägerin, die ursprünglich einmal die niederländische Staatsangehörigkeit besaß, über einen Zeitraum von 16 Jahren in den Niederlanden auf und bekam dort mit einem niederländischen Staatsangehörigen drei Kinder, die gleichfalls die niederländische Staatsangehörigkeit besaßen. Die Klägerin kümmerte sich um die Kinder, während der Ehemann und Vater im Schichtbetrieb arbeiten ging. Aber auch in Anbetracht dieser außergewöhnlichen Umstände forderte der EGMR im Hinblick auf den Ermessensspielraum in Einwanderungsangelegenheiten eine umfassende Abwägung der persönlichen Interessen der Klägerin mit dem öffentlichen Interesse der niederländischen Regierung an einer Einwanderungskontrolle (EGMR Urt. v. 3.10.2014 – 12738/10 Rn. 121 – Jeunesse/Niederlande).
In der Rechtssache Sen gegen die Niederlande bejahte der EGMR eine Verletzung des Art. 8 EMRK im Hinblick auf den Nachzug eines Kindes, das bei einer Tante in der Türkei lebte. Die beiden in den Niederlanden rechtmäßig lebenden türkischen Eltern hatten zwei weitere Kinder, die in den Niederlanden geboren und aufgewachsen sind. Der Gerichtshof betonte auch in dieser Rechtssache, dass aus Art. 8 EMRK kein Recht auf die Wahl des Aufenthaltsorts zur Ermöglichung des Familienlebens folgt. Aufgrund des Umstands, dass die beiden Geschwister der Klägerin in den Niederlanden aufgewachsen waren, dort die Schule besuchten und keine Bindungen in die Türkei hatten, sah der Gerichtshof allein die Begründung der Familieneinheit in den Niederlanden als verhältnismäßig an (EGMR Urt. v. 21.12.2001 – 31465/96, InfAuslR 2002, 334 – Sen/Niederlande).
Dass eine Familie auch dauerhaft getrennt werden kann, hat der EGMR in der Rechtssache Gül gegen die Schweiz entschieden (EGMR Urt. v. 19.2.1996 – 23218/94, InfAuslR 1996, 245 – Gül/Schweiz). Das Ehepaar Gül, das in der Türkei zwei Söhne zurückgelassen hatte, bekam aufgrund der Erkrankung der Mutter und des langen Aufenthalts des Vaters sowie des Umstands, dass ein weiteres Kind in der Schweiz geboren worden war, einen humanitären Aufenthaltstitel. Der Nachzug der beiden in der Türkei verbliebenen Kinder wurde von den Schweizer Behörden abgelehnt. In der Entscheidung des Gerichtshofs ging es um die Frage, ob der jüngere Sohn, der bei Stellung des Nachzugsantrags sechs Jahre alt war, einen Anspruch auf Familiennachzug hat. Auch in dieser Entscheidung betont der Gerichtshof zunächst das Recht der Staaten auf Einwanderungskontrolle. Aus Art. 8 EMRK könne keine Verpflichtung eines Staates abgeleitet werden, die Entscheidung von Ausländern über den Ort des Familienlebens akzeptieren zu müssen. Der EGMR verwies die Eltern auf eine Rückkehr in die Türkei, sofern sie die Familieneinheit mit ihrem dort lebenden minderjährigen Sohn herstellen wollten.
Besteht zwar kein Anspruch auf Familiennachzug aus Art. 8 EMRK, so muss das nationale Recht aber eine Güterabwägung ermöglichen, die in Einzelfällen den Familiennachzug zulässt. Die erforderliche menschenrechtliche Abwägungsentscheidung orientiert sich zwar an abstrakten Kriterien, deren Gewichtung aber immer einzelfallbezogen erfolgt, sodass eine Prognose über den Ausgang der Abwägungsentscheidung kaum möglich ist.
Nichts anderes gilt für das BVerfG, wenn es in einer Grundsatzentscheidung aus dem Jahr 1987 zwar heißt, dass dem „besonderen Schutz“, der Ehe und Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG zukommt, kein individuelles Nachzugsrecht zu entnehmen sei, aber ein vollständiger Ausschluss des Nachzugs keine alternative Maßnahme sei. Das BVerfG hat bisher nur wenige Entscheidungen zum Familiennachzug getroffen, die zum einen Wartezeiten, zum anderen Integrationsanforderungen betrafen. Im Hinblick auf Art. 6 Abs. 1 GG als wertentscheidender Grundsatznorm hat das BVerfG eine Ehebestandszeit von drei Jahren für den Nachzug des Ehepartners zu einem seit mehr als acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebenden Ausländer als unverhältnismäßig eingestuft. In weiteren Entscheidungen wurden Wartezeiten von bis zu zwei Jahren für verhältnismäßig angesehen.
Auch aus europarechtlicher Einschätzung finden sich keine durchgreifenden Beanstandungen des vorgelegten Gesetzesentwurfs zum Aussetzen des Familiennachzugs bei subsidiär Schutzberechtigten. Denn die Familienzusammenführungs-RL findet keine Anwendung, wenn der Aufenthalt des Zusammenführenden aufgrund „subsidiärer Schutzformen gemäß internationalen Verpflichtungen, einzelstaatlicher Rechtsvorschriften oder Praktiken der Mitgliedstaaten genehmigt wurde“.
Auch die EU-Grundrechtscharta räumt keine Ansprüche auf Familiennachzug ein. Denn nach der Regelung des Art. 52 Abs. 2 GRCh haben EU-Grundrechte dieselbe Bedeutung und Tragweite wie Gewährleistungen der EMRK, wenn sie ihnen entsprechen. Da Art. 7 GRCh identisch ist mit der Vorschrift des Art. 8 Abs. 1 EMRK, entwickelt er keine darüberhinausgehende Bedeutung und Tragweite. Insofern gelten im Hinblick auf Art. 7 GRCh dieselben Grundsätze, wie sie der EGMR für Art. 8 EMRK entwickelt hat.
Der Kinderrechtskonvention (KRK) lässt sich gleichfalls kein zwingender Vorrang vor anderen Belangen entnehmen. Denn die KRK nimmt Belange, die einem Nachzug entgegenstehen könnten, nicht in Blick. Sie gibt dem Gesetzgeber aber vor, das Kindeswohl als einen grundlegenden Gesichtspunkt zu berücksichtigen. Die deutsche Diskussion um das Kindeswohl leidet unter einer missverständlichen deutschen Übersetzung, die freilich die völkerrechtliche KRK-Interpretation nicht beeinflusst, weil diese sich gem. Art. 54 KRK einzig nach den authentischen Sprachfassungen richtet. So bezeichnet die informelle deutsche Übersetzung des Art. 3 Abs. 1 KRK das Kindeswohl als einen „Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist“. Mit dem Adjektiv vorrangig wird nicht etwa abstrakt ein Vorrang vor allen anderen Belangen postuliert, sondern es wird die Bedeutung des Kindeswohls bei allen Entscheidungen des Gesetzgebers in den Fokus gerückt. So muss das Kindeswohl als ein entscheidender Faktor bei neuen Gesetzen in den Blick genommen werden.
Dies lässt auch die Denkschrift zu dem Übereinkommen erkennen. Dort wird zu Art. 3 Abs. 1 KRK ausgeführt: Das Wohl des Kindes ist dagegen nach Art. 3 Abs. 1 „ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist“. Absoluter Vorrang gegenüber allen anderen Belangen sollte dem Wohl des Kindes nicht eingeräumt sein. Im ursprünglichen polnischen Entwurf war allerdings ein weitergehender Vorschlag enthalten („… the best interests of the child shall be the paramount consideration“). Angenommen wurde indessen ein Formulierungsvorschlag der Vereinigten Staaten („… the best interests of the childshall be a primary consideration“), nachdem in der Diskussion geltend gemacht worden war, dass es Fälle geben könne, in denen die Interessen anderer Beteiligter gleichgewichtig oder sogar als vorrangig zu bewerten sind, so zB die Belange der Mutter bei einem während der Geburt eintretenden Notfall.
Die adjektivische Formulierung „primary/primordiale“ bezeichnet einen hohen Stellenwert, ohne notwendig einen hierarchischen Vorrang vorzugeben. Es kann andere „primary/ primordiale“ Gesichtspunkte geben, die konzeptuell gleichwertig sind. Die Denkschrift zu dem Abkommen lässt unzweifelhaft erkennen, dass die Abschwächung der Bedeutung des Kindeswohls durch die Benutzung der Begriffe „primary consideration“ und „considération primordiale“ statt der noch in der UN-Erklärung über die Kinderrechte von 1959 benutzten Formulierungen „paramount consideration“ und „la considération déterminante“ eine bewusste Entscheidung im Rechtsetzungsverfahren der KRK war.
Sichergestellt werden muss allein, dass Härtefällen Rechnung getragen werden muss. Dieser Verpflichtung kommt der Gesetzentwurf mit dem Verweis auf die §§ 22 f. AufenthG nach. Dabei ist zu beachten, dass die Härtefallprüfung keinesfalls ohne Wartezeit erfolgen muss, sodass die geplante Neuregelung sogar über die Vorgaben des EGMR und des BVerfG hinausgeht.
Fazit: Aus dem Vorstehenden folgt, dass der Gesetzgeber über einen prinzipiellen Gestaltungsspielraum für die Gewährleistung des Familiennachzugs verfügt. Es obliegt im demokratischen Rechtsstaat dem Parlament, diesen grundrechtlichen Spielraum mit politischem Gestaltungswillen auszufüllen. Dies gilt erst recht, wenn ein Familiennachzug in das Sozialsystem erfolgen soll.