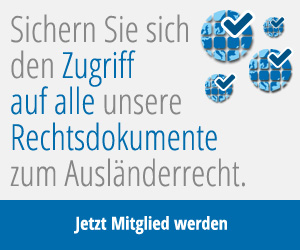Die Bundesregierung plant eine zeitnahe Umsetzung der EU-Verordnungen zum Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS-Reform). Die vorgelegten Gesetzentwürfe eines Gesetzes zur Anpassung des nationalen Rechts an die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS-Anpassungsgesetz) sowie eines Gesetzes zur Änderung des AZRG und weiterer Gesetze in Folge der Anpassung des nationalen Rechts an das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS-Anpassungsfolgegesetz) werden keine Beschleunigung der Asylverfahren bewirken, sondern eine Verfahrensflut verursachen, die die Verwaltungsgerichte überlasten wird. Folge der Überlastung werden längere Laufzeiten sein, womit der Zweck der GEAS-Reform konterkariert wird.
Insbesondere zwei Regelungen werden die Belastung der Verwaltungsgerichte vervielfachen:
Zum einen wird die Abschiebungsandrohung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf die Ausländerbehörden übertragen. Ist das Bundesamt aufgrund der Vorgaben der Rückführungsrichtlinie gehindert, eine Abschiebungsandrohung zu erlassen, soll diese Zuständigkeit nach der Neuregelung des § 39 Satz 1 AsylG n. F. nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens auf die Ausländerbehörden übergehen, da diese dann für den Erlass von Entscheidungen und Maßnahmen zur Beendigung des Aufenthalts zuständig sind.
Dies klingt wenig spektakulär, hat aber erhebliche Auswirkungen auf die Anzahl der eingehenden verwaltungsgerichtlichen Verfahren. Denn gegen die Abschiebungsandrohung sind erneut Klage und Eilantrag möglich, sodass nach Durchführung eines Asylklageverfahrens ein neues Klageverfahren beginnen wird. Aus einem Asylklageverfahren werden so schnell drei Verfahren. Dass sich die Laufzeiten der gerichtlichen Verfahren durch die Eröffnung des Klageweges gegen die Abschiebungsandrohung der Ausländerbehörden nicht verkürzen werden, liegt auf der Hand.
Zum anderen hat der Gesetzgeber durch unklare Regelungen die Grundlage dafür gelegt, dass auch die Berufungsgerichte sich über eine Verfahrensflut freuen dürfen. Nach Art. 68 Abs. 7 AsylVf-VO hat ein Antragsteller, der einen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über einen ersten Rechtsbehelf einlegt, grundsätzlich kein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats. Das Gericht kann auf Antrag des Antragstellers oder von Amts wegen aber auch im Rechtsmittelverfahren einen Verbleib im Mitgliedstaat erlauben, wenn der Grundsatz der Nichtzurückweisung geltend gemacht wurde. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfolgt durch Anfügen eines Absatzes 9 in § 78 AsylG, der folgenden Inhalt hat:
„(10) Der Antrag auf das Recht auf Verbleib nach Artikel 68 Absatz 7 der Verordnung 2024/1348 ist innerhalb eines Monats bei dem zuständigen Rechtsmittelgericht zu stellen. Das Rechtsmittelgericht soll über den Antrag innerhalb von zwei Wochen entscheiden. Vor Ablauf der Frist nach Satz 1 und bis zur Entscheidung über den fristgemäß gestellten Antrag ist die Abschiebung nicht zulässig.“
Im Kern bedeutet die Einführung des Rechts auf Verbleib, dass zu jedem Berufungszulassungsverfahren ein Eilverfahren hinzukommen wird. Da die Berufungsgerichte bereits jetzt kaum in der Lage sind, die Zulassungsverfahren innerhalb eines Jahres zu entscheiden, wird die Frage aufkommen, wie die Verfahrensflut an neuen Eilverfahren, mit denen das Recht auf Verbleib eingefordert wird, entschieden werden kann. Die Frist von zwei Wochen erscheint im Hinblick auf die Gesamtbelastung der Berufungsgerichte realitätsfern.
Soweit die Begründung darauf hinweist, dass es sich bei dem Eilverfahren auf Verbleib um eine Spezialregelung zu § 80b VwGO handelt, wird damit eine Abgrenzung beider Verfahren nicht hinreichend klar vorgenommen. Ebenso fehlen jegliche Anhaltspunkte für einen rechtlichen Maßstab. Damit würde die Gestattung eines weiteren Verbleibs allein im freien richterlichen Ermessen mit der Gefahr einer sehr unterschiedlichen Handhabungspraxis liegen. Im Falle einer Stattgabe des Antrags auf ein Recht auf Verbleib lebt nach dem derzeitigen Entwurf die Aufenthaltsgestattung wieder auf. Diese Rechtsfolge mit ihrer für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber hinderlichen Wirkung erweist sich dabei als vermeidbar, da das Unionsrecht die Rechtmäßigkeit des Aufenthalts nicht verlangt.
Ferner droht mit dieser Regelung eine erhebliche Mehrbelastung der Rechtsmittelgerichte, da infolge des Gesetzentwurfs mehrere Eilverfahren beim Berufungsgericht anhängig gemacht werden können:
- Der Antrag auf Verbleib, der der Sicherung des Verfahrens auf Zulassung der Berufung dient.
- Anträge, die sich nach § 80b Abs. 2 VwGO gegen die Vollziehbarkeit der Abschiebungsandrohung richten: Mit Abweisung der erstinstanzlichen Asylklage entfällt die aufschiebende Wirkung der Anfechtungsklage gegen die Abschiebungsandrohung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, da die Regelung des § 75 Abs. 1 AsylG, wonach in den Fällen des § 38 Abs. 1 AsylG die Anfechtungsklage gegen die Abschiebungsandrohung aufschiebende Wirkung entfaltet, ersatzlos aufgehoben wird.
Das Berufungsgericht wird also mit Eingang des Antrags auf Zulassung der Berufung als „Gericht der Hauptsache“ nicht nur für Anträge auf Verbleib, mit denen das Bleiberecht bis zum Abschluss des Zulassungsverfahrens gesichert werden soll, zuständig (vgl. auch § 123 Abs. 2 Satz 2 VwGO), sondern auch für die Bearbeitung von Eilverfahren, die insbesondere auf eine Aussetzung der Abschiebung aus familiären und gesundheitlichen Gründen abzielen (zur Zuständigkeit: BVerwG, Beschluss vom 4. November 2021 – 6 AV 9/21 –, BVerwGE 174, 102-109, Rn. 14 für Anträge nach § 123 Abs. 1 VwGO und BVerwG, Beschluss vom 5. Januar 1972 – VIII CB 120.71 –, BVerwGE 39, 229-231, Rn. 6 für Anträge nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO).
Im Hinblick auf die mit Einführung der Bleiberechtsverfahren verbundene Mehrbelastung der Instanzgerichte und die Notwendigkeit, diese Verfahren beschleunigt zu bearbeiten, sollte eine grundlegende Änderung des asylrechtlichen Berufungszulassungsverfahrens in Erwägung gezogen werden.
Hinzuweisen ist zunächst darauf, dass das Unionsrecht keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten vorsieht, Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte erster Instanz zu eröffnen. In Anbetracht des Ziels der GEAS-Reform, Asylverfahren zügig zu beenden und abgelehnte Asylbewerber zeitnah in ihre Herkunftsländer zurückzuführen, erscheint es sinnvoll, die gegenwärtige Regelung der Berufungszulassung zu hinterfragen. Auch die sehr geringen Erfolgsaussichten im asylrechtlichen Zulassungsverfahren sprechen dafür, das Rechtsmittel der Berufung in Asylverfahren grundsätzlich nicht mehr auf Antrag eines Beteiligten zuzulassen. Vielmehr sollten die Verwaltungsgerichte bei grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache die Berufung zulassen können. Hierdurch kann eine effektive Vereinheitlichung der Rechtsprechung zur Verfolgungssituation in einzelnen Herkunftsländern erreicht werden.
Fazit: Die sich abzeichnende Mehrbelastung der Verwaltungsgerichte wird absehbar zu einer Überlastung dieser Gerichtsbarkeit führen. Die Kapazitäten, die die Verfahrensflut im Asylrecht binden wird, stehen für die Bearbeitung normaler Klageverfahren nicht mehr zur Verfügung.