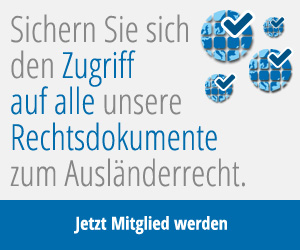Sucht man einen Verantwortlichen für das bevorstehende Scheitern der bevorstehenden Anpassung des deutschen Asylrechts an das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEAS-Anpassungsgesetz), so dürfte letztlich der Gerichtshof der Europäischen Union für den Sargnagel des deutschen Asylrechts verantwortlich sein. Die Untätigkeit des Gesetzgebers in Ansehung der bekannten EuGH-Rechtsprechung trägt gleichwohl einen maßgeblichen Anteil an dem bevorstehenden Scheitern der auf Beschleunigung ausgerichteten Asylrechtsnovelle, da die Zuständigkeit für den Erlass von Abschiebungsandrohungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf die Ausländerbehörden übergehen wird.
Was sind die Gründe für das Scheitern des neuen Asylrechts?
Ausgangspunkt des Problems ist die im deutschen Asylrecht verankerte aufenthaltsrechtliche Systematik, die darin besteht, dass auch nach einer Asylablehnung der Aufenthalt während des sich anschließenden Klageverfahrens – mit wenigen Ausnahmen – rechtmäßig bleibt. Die Aufenthaltsgestattung erlischt im Regelfall nach § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 AsylG erst mit Unanfechtbarkeit der Entscheidung des Bundesamtes. Dies hat zur Folge, dass eine Abschiebungsandrohung auf Grundlage des § 34 AsylG zusammen mit der Asylentscheidung ergeht, wobei nach § 38 Abs. 1 Satz 2 AsylG die Ausreisefrist im Falle der Klageerhebung erst 30 Tage nach dem unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens beginnt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Rückführungsentscheidung – die Abschiebungsandrohung – ergeht, die während des Klageverfahrens nicht vollzogen werden kann, weil der Aufenthalt rechtmäßig ist und die Ausreisefrist erst nach unanfechtbarem Abschluss des Asylverfahrens zu laufen beginnt. Es handelt sich letztlich um eine auf Vorrat ergehende Rückführungsentscheidung, die mit der Rückführungsrichtlinie nicht im Einklang steht.
Der Gesetzgeber versucht mit der Neuregelung, das bisherige Konzept des § 67 AsylG fortzuschreiben, da auch während des erstinstanzlichen Klageverfahrens die Aufenthaltsgestattung bestehen bleiben soll. Diese Konzeption sollte im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zur Rückführungsrichtlinie dringend überdacht werden, da zu erwarten steht, dass das Bundesamt zukünftig keine Abschiebungsandrohungen mehr erlassen darf, da der Asylbewerber aufgrund der Entscheidung des Bundesamtes nicht ausreisepflichtig wird, sofern er gegen die Ablehnungsentscheidung des Bundesamtes klagt. Insbesondere das Anliegen der EU-Asylverfahrensverordnung (im Folgenden: AsylVf-VO), die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen, wird durch die Neuregelung konterkariert.
§ 67 Abs. 1 des Entwurfs des GEAS-Anpassungsgesetzes (im Folgenden: AsylG-E) sieht vor, dass die Aufenthaltsgestattung an das Bestehen des Rechts auf Verbleib nach der AsylVerf-VO geknüpft wird:
„(1) Die Aufenthaltsgestattung erlischt, wenn ein Recht auf Verbleib nach der Verordnung (EU) 2024/1348 nicht besteht oder nicht mehr besteht (…).“
Da nach Art. 68 Abs. 7 AsylVerf-VO ein Antragsteller, der einen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung über einen ersten oder einen weiteren Rechtsbehelf einlegt, kein Recht auf Verbleib im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats hat, entfällt mit dem erstinstanzlichen Urteil die Aufenthaltsgestattung, sofern das Berufungsgericht nicht anordnet, dass das Recht auf Verbleib für die Dauer des Rechtsmittelverfahrens wieder auflebt.
Nach jetzigem Recht, wie auch nach dem GEAS-Anpassungsgesetz wird daher für den Normalfall (kein beschleunigtes Verfahren oder Grenzverfahren) nach Erlass der Abschiebungsandrohung der Aufenthalt zumindest für die Dauer des erstinstanzlichen Verfahrens rechtmäßig bleiben.
Dies ist keinesfalls erforderlich. Der Gesetzgeber geht offensichtlich von einer unzutreffenden Auslegung des unionsrechtlichen Rechts auf Verbleib in der AsylVf-VO aus, weil er diese Rechtsstellung mit rechtmäßigem Aufenthalt gleichsetzt. Das Recht auf Verbleib, das in Art. 10 Abs. 1 AsylVf-VO verankert ist, regelt indes die Rechtsstellung, die für den Schutzsuchenden mit dem Verbleiberecht einhergeht, nur sehr zurückhaltend:
„(1) Antragsteller sind berechtigt, im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats, in dem sie sich gemäß Artikel 17 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2024/1351 aufzuhalten haben, zu verbleiben, bis die Asylbehörde im Verwaltungsverfahren gemäß Kapitel III eine Entscheidung über den Antrag getroffen hat.“
Aus der Formulierung „berechtigt (…) zu verbleiben“ kann nicht geschlossen werden, dass dem Schutzsuchenden ein Aufenthaltsstatus, wie er durch eine Aufenthaltsgestattung begründet wird, verliehen werden muss. Denn Art. 68 Abs. 1 der AsylVf-VO verlangt lediglich, dass die Wirksamkeit der Rückführungsentscheidung gehemmt ("ausgesetzt") wird, nicht aber die Begründung eines (erneuten) rechtmäßigen Aufenthalts:
„(1) Die Wirkungen einer Rückkehrentscheidung werden automatisch ausgesetzt, solange ein Antragsteller oder eine Person, der der internationale Schutz aberkannt wurde, nach diesem Artikel ein Recht auf Verbleib hat oder ihm oder ihr der Verbleib gestattet ist.“
Erscheint die Regelung auf den ersten Blick als rechtlich unproblematisch, weil sie die Schutzsuchenden durch Verleihung rechtmäßigen Aufenthalts nur begünstigt, so ändert sich diese Sichtweise, wenn die aktuelle Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Rückführungsrichtlinie in den Blick genommen wird. Diese Rechtsprechung wird in den Standardfällen der Ablehnung eines Asylbegehrens als einfach unbegründet dem Erlass von Abschiebungsandrohungen entgegenstehen und diese über § 39 AsylG-E auf die Ausländerbehörden verlagern. Denn der Gerichtshof hat zuletzt in der Rechtssache Kaduna (Urteil vom 19. Dezember 2024 - C-290/24 -, Rn. 140 ff.) entschieden, dass die Rückführungsrichtlinie einen Mitgliedstaat daran hindert,
„eine Rückkehrentscheidung gegen einen Drittstaatsangehörigen zu erlassen, der sich rechtmäßig in seinem Hoheitsgebiet aufhält“.
Allein
„der Umstand, dass die zuständige nationale Behörde in der Rückkehrentscheidung ausdrücklich feststellt, dass diese keine Wirkung entfaltet, solange der Aufenthalt des Betroffenen weiterhin legal ist“,
ändert an der Rechtswidrigkeit der Abschiebungsandrohung nichts. Begründet wird dies unter anderem damit, dass keine Rückkehrentscheidung ergehen darf, ohne dass die nationale Behörde die Umstände berücksichtigen konnte,
“die möglicherweise zwischen dem Erlass der Entscheidung und der Beendigung des rechtmäßigen Aufenthalts der betreffenden Person eintritt und sich erheblich auf die Prüfung der Lage dieser Person anhand der Richtlinie 2008/115, insbesondere deren Art. 5, auswirkt“.
Diese Rechtsprechung, die lediglich die Fortführung der bisherigen Rechtsprechungslinie darstellt, hat zur Folge, dass die Regelung in § 38 Abs. 2 AsylG‑E, wonach die Ausreisefrist im Falle der Klageerhebung erst beginnt, wenn der Antragsteller kein Recht auf Verbleib mehr hat, unionswidrig ist. Denn mit der Klageerhebung wird die Aufenthaltsgestattung über das Asylverfahren beim Bundesamt hinaus verlängert, sodass eine Abschiebungsandrohung erlassen wurde, obwohl der Aufenthalt weiterhin rechtmäßig ist.
Dies gilt auch für die aktuelle Rechtslage!
Durch die Fortführung der Gestattung über das behördliche Asylverfahren hinaus, wird ein Zustand geschaffen, der es dem Bundesamt – mit Ausnahme von „Dublin-Verfahren“, die nicht der Rückführungsrichtlinie unterfallen – unmöglich macht, Abschiebungsandrohungen zu erlassen. Erlischt die Aufenthaltsgestattung nicht bereits mit Abschluss des behördlichen Asylverfahrens, sondern nach § 67 Abs. 1 Nr. 5 AsylG-E erst dann, wenn eine nach diesem Gesetz erlassene Abschiebungsandrohung vollziehbar geworden ist, geht nach § 39 AsylG-E die Zuständigkeit für den Erlass von Abschiebungsandrohungen auf die Ausländerbehörden über.
Dies mag auf den ersten Blick nicht besonders dramatisch klingen, jedoch beginnt die Zuständigkeitsverlagerung erst mit dem „unanfechtbaren Abschluss des Asylverfahrens“. Konkret bedeutet dies, dass nach Abschluss des behördlichen und gerichtlichen Asylverfahrens die Rechtsschutzmöglichkeiten über die Abschiebungsandrohung der Ausländerbehörde erneut eröffnet werden. An das Asylverfahren schließt sich nahtlos ein aufenthaltsrechtliches Verfahren an, in dem – der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union sei gedankt – nicht nur familiäre und gesundheitliche Gründe geltend gemacht werden können, sondern auch zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote (Grundsatz der Nichtzurückweisung nach Artikel 5 der Rückführungsrichtlinie).
Fazit: Das Fortbestehen der Aufenthaltsgestattung für die Dauer eines Verwaltungsstreitverfahrens nach Ablehnung des Asylantrags durch das Bundesamt in § 67 Abs. 1 AsylG-E und die Regelung in § 38 Abs. 2 Satz 3 AsylG-E, wonach die Ausreisefrist im Falle der Klageerhebung erst beginnt, wenn der Antragsteller kein Recht auf Verbleib mehr hat, werden aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union dazu führen, dass die Ausländerbehörden in Fällen, in denen der Asylbewerber Klage erhebt, die Abschiebungsandrohungen nach Abschluss des erstinstanzlichen Verwaltungsstreitverfahrens zu erlassen haben werden. Die sich hierdurch eröffnenden Rechtsschutzmöglichkeiten konterkarieren das gesetzliche Anliegen, die Rückführung abgelehnter Asylbewerber zu beschleunigen.
Mainz, 18.11.2025
Dr. Klaus Dienelt