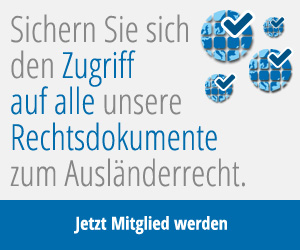Wenn nach der Integration ausländischer Familie und dem Verständnis des deutschen Gesetzgebers von dieser Aufgabe gefragt wird, ist zunächst der genauere Gegenstand der Untersuchung festzulegen, nämlich die Begriffe der Integration und der ausländischen Familien.
Begriffsbestimmung: Integration
Unter ausländischer Familie sind hier die in Deutschland lebenden Angehörigen eines Familienverbands zu verstehen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Auf ihre Herkunft im Einzelnen kommt es nicht an. Maßgeblich für ihre besondere Betrachtung sind nur ihre familiäre Verbundenheit aufgrund ihrer Verwandtschaft und ihrer gemeinsamen Lebens in Deutschland. Damit soll die Betrachtung hier nicht auf alle Familien ausgeweitet werden, in denen zumindest eine Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder allgemein gesprochen über einen Migrationshintergrund verfügt. Hierzu wären zunächst alle Mitglieder einer deutsch-ausländischen Familie zu zählen. Unter Umständen gehörten aber alle diejenigen dazu, die selbst oder deren Vorfahren einmal ihren Lebensmittepunkt über eine Staatsgrenze hinweg verlegt haben, also nach Deutschland zugezogen sind. Eine solche Ausweitung wäre aus verschiedenen Gründen berechtigt und angezeigt – der Integrationsbedarf in diesen Familien ist nicht zu verkennen –, würde aber den hier zur Verfügung stehenden Rahmen sprengen. Die Untersuchung soll grundsätzlich auf die rein ausländische Familie beschränkt und nur ausnahmsweise auf Statusdeutsche (eine nur in Deutschland bekannte Form der Staatsangehörigkeit) erstreckt werden.
Nun zur Integration. Einen bestimmten Integrationsbegriff im Hinblick auf die Zuwanderung kennt das deutsche Recht nicht. Es werden zwar in Gesetzen und anderen Vorschriften an zahlreichen Stellen Tatsachen und Anzeichen genannt, mit denen „Integration“ beschrieben werden könnte, dieser Begriff selbst wird aber dort, wo er bisher zur Kennzeichnung von Zuständigkeiten und Verfahren verwandt wurde, nicht weiter erklärt. Soweit er jetzt erstmalig in dem Zuwanderungsgesetz im Zusammenhang mit Eingliederungsbemühungen und Integrationskursen genannt ist, ist Gegenstand der dort zugesagten Förderung die Integration in das wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Leben. In ähnlicher Weise wird für die Einbürgerung von Ehegatten Deutscher seit 1969 die Gewähr verlangt, dass diese sich in die deutschen Lebensverhältnisse einordnen.
{mosgoogle} An dieser Stelle soll nicht näher der Frage nachgegangen werden, welchen Inhalt diese Begriffe für den jeweiligen Sachbereich aufweisen und ob die deutsche Rechtsordnung außer dem Begriff der Integration Umschreibungen desselben Vorgangs an anderer Stelle bereithält. Festgehalten werden kann hier jedenfalls Dreierlei: Ersten ist Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse nicht mit Assimilation als dem vollständigen Aufgehen in der deutschen Umgebung gleichzusetzen. Zweitens braucht Integration nicht alle Lebensbereiche zu umfassen, es sind vielmehr unterschiedliche Formen der Teilintegration denkbar. Drittens schließt Integration grundsätzlich die Möglichkeit ein, dass sich während dieses Vorgangs auch die Aufnahmegesellschaft ändert.
Vielfalt von Integration
Untersucht man das deutsche Recht nach Hinweisen auf Integrationsziele und dazu ausgewählte Mittel, Maßnahmen und Verfahren, ist eine breite Vielfalt feststellen. Ein einheitliches Integrationsziel lässt sich ebenso wenig finden wie ein bestimmter Plan für Inhalte und Verfahren. Aus diesem Grunde kann den einschlägigen Normen auch für die ausländische Familie kein gesetzlicher Entwurf für ein Integrationsprogramm entnommen werden. Weder gibt es solche eindeutigen Festlegungen noch können sie aus dem Inhalt gesetzlicher Regelungen heraus ermittelt oder geschlossen werden. Eine kursorische Gesamtbetrachtung vermittelt eher den Eindruck, als richteten sich Ziele und Pläne von Integration nach dem jeweils geregelten Lebensbereich und nach dem Status des jeweils betroffenen Nichtdeutschen.
Beginnen wir mit den Statusdeutschen, die hier wie in anderer Beziehung eine Sonderrolle im Schnittfeld zwischen Deutschen und Ausländern einnehmen. Bei ihnen ist die Integrationsfähigkeit einerseits unterstellt und andererseits gänzlich unerheblich. Die grundgesetzliche Regelung ihrer Aufnahme in Deutschland (Art. 116 I GG) verlangt von dem deutschen Volkszugehörigen im Grundsatz nur den Nachweis seiner deutschen Volkszugehörigkeit und lässt für den nichtdeutschen Familienangehörigen dessen Verwandtschaft und Abkommenschaft genügen. Die Integration des Nichtdeutschen mit Hilfe seines deutschen Stammberechtigten wird unwiderleglich prognostiziert: Die Rechtsfolge tritt bei den deutschen wie dem nichtdeutschen Familienmitgliedern automatisch ein und besteht nicht etwa nur in dem Erklimmen eines besonderen ausländerrechtlichen Status, sondern letztlich im Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit (vgl. § 7 StAG). Den Ausländerstatus behält nur, wer als Familienangehöriger nicht in den Aufnahmebescheid einbezogen ist oder nicht mit einreist. Die rechtliche Einordnung wird dadurch kompliziert, dass die mitreisenden nichtdeutschen Familienangehörigen zwar Statusdeutsche werden (Art. 116 I GG), nicht aber Spätaussiedler (§§ 4, 26 BVFG), dass sie aber dann ebenso wie die Stammberechtigten mit der Aushändigung der Bescheinigung über die Einreise mit einem Spätaussiedler die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben (§ 7 StAG i.V.m.§§ 7 II, 15 II BVFG).
Als weiterer Sonderfall kann die Einbürgerung Deutschverheirateter gelten. Diese müssen ihre Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse gewährleisten. Grundsätzlich wird bei ihnen die Eignung zum Erreichen des Integrationsziels zugrunde gelegt und angenommen, seine Entwicklung hin zu einem integrierten Teil der deutschen Gesellschaft werde durch das Zusammenleben mit einem Deutschen begünstigt, erleichtert und beschleunigt. Wer schließlich als ausländischer Familienangehöriger lediglich einen gesicherten Aufenthalt und nicht sogleich die Aufnahme in den deutschen Staatsverband anstrebt, wird hinsichtlich der Integration wesentlich differenzierter behandelt. Bei ihm geben in erster Linie der eigene aufenthaltsrechtliche Status und der der anderen Familienmitglieder den Ausschlag dafür, ob und welche Integrationsleistungen gefordert werden. Die Bedingungen für Einreise und Aufenthalt wiederum werden von den Staaten innerhalb völkerrechtlicher Bindungen frei bestimmt. Die Kriterien für die Zulassung zum Staatsgebiet sind meist, aber nicht unbedingt an der Fähigkeit und Bereitschaft zur Integration ausgerichtet. Die Familienangehörigen sind in das jeweilige Zulassungssystem eingebunden und unterliegen folglich ebenso verschiedenartigen Integrationsvoraussetzungen, wenn nicht auch bei ihnen hierauf verzichtet wird. Auch in diesem Sinne sind ihre Rechtspositionen eng mit denen des Stammberechtigten verbunden und von diesen abhängig.
{mosgoogle}
Nach alledem ist hinsichtlich der Integration der Familie zunächst einmal grundlegend zwischen Unionsbürgern und Drittstaatsangehörigen zu unterscheiden. Zu den letzteren sind auch diejenigen Familienangehörigen eines Spätaussiedlers zu zählen, die nicht im Zuge des Aufnahmeverfahrens, sondern unabhängig davon einreisen, also im wirklichen Wortsinne nachziehen.
Unionsbürger
Die Zuwanderung von Unionsbürgern unterliegt grundsätzlich keiner behördlichen Regulierung. Staatsangehörige von EWR-Staaten und (grundsätzlich auch) der Schweiz stehen insoweit gleich. Die Personenverkehrsfreiheiten gewährleisten die Freizügigkeit im gesamten Hoheitsgebiet der EU-Staaten (nur) aufgrund der Staatsangehörigkeit in einem dieser Länder. Die Entscheidung zur Migration liegt bei dem einzelnen Bürger, und ihm allein bleibt es auch überlassen, ob, zu welchem Zweck, in welchem Umfang und auf welche Weise er sich in die Lebensverhältnisse des jeweiligen Aufenthaltsmitgliedstaats einzuordnen entschließt. Für den möglichen Erfolg ist er selbst verantwortlich. Gelingt ihm die Integration nicht, treffen ihn keine Sanktionen, sondern allenfalls tatsächliche Nachteile, wie sie auf einem freien Markt üblich sind. Selbst wenn er eine Integration gar nicht ernsthaft versucht oder sie ihm aus welchen Gründen auch immer misslingt, enden damit seine unionsweiten Freizügigkeitsrechte nicht. Gerade nach der jüngsten EU-Erweiterung wird deutlich, welche starke Rechtsstellung die Union ihren Bürgern gewährleistet und zutraut. Auch wenn die ökonomischen und kulturellen Verhältnisse eine beeindruckende Vielfalt aufweisen und insbesondere die Sprachbarrieren eine Integration schon in mehreren und erst recht in allen Mitgliedstaaten gleichzeitig oder nach einander erheblich erschweren, ist die Freizügigkeit keinen integrationsbezogenen Beschränkungen unterworfen.
{mosgoogle}
Hinsichtlich der Familienangehörigen soll es hier mit dem Hinweis, dass im Gemeinschaftsrecht das Zusammenleben im Familienverband als positiver Integrationsfaktor gefördert wird, sein Bewenden haben (vgl. dazu näher die Abhandlung von Renner: „Schutz von Ehe und Familie von Zuwanderern“ .
Drittstaatsangehörige
Wer nicht aus einem EU-Staat, einem EWR-Staat (Liechtenstein, Island, Norwegen) oder der Schweiz stammt (hier als Drittstaatsangehöriger verstanden), ist in Deutschland für Einreise und Aufenthalt einem strengen Reglement unterworfen. Familienangehörige nehmen an dieser Rechtsstellung teil und können nur unter besonderen Umständen eine aufenthaltsrechtliche Selbständigkeit erlangen. Die Zulassung des Zusammenlebens mit dem Stammberechtigten ist nicht etwa einheitlichen Anforderungen für alle Aufenthaltszwecke und Aufenthaltstitel unterworfen, sondern eben von diesen abhängig. Zudem werden Integrationsnachweise teilweise unmittelbar von den Angehörigen selbst verlangt, teilweise wird jedoch auf die Integration des Stammberechtigten aufgebaut und von weiteren Anforderungen an die Familienmitglieder abgesehen. An der Spitze der Pyramide stehen im Aufenthaltsrecht wie bei der Einbürgerung die Angehörigen von Deutschen. Für den Zuzug und den Aufenthalt von Ehegatten, minderjährigen ledigen Kindern, sorgeberechtigten Elternteilen und sonstigen Verwandten wird zunächst nur die Führung einer familiären Lebensgemeinschaft im Inland vorausgesetzt. Grundlage ist also die Verwirklichung der rechtlich begründeten gegenseitigen Verbundenheit aufgrund Ehe oder Abstammung, im Falle der sonstigen Familienmitglieder zusätzlich das existentielle Angewiesensein auf die Lebenshilfe des anderen.
{mosgoogle}
Rechtsansprüche auf ein familiäres Zusammenleben sind teilweise auch anderen Ausländern eingeräumt, falls ihre bereits in Deutschland lebenden Partner oder Eltern über ein gesichertes Aufenthaltsrecht in Form einer Aufenthaltsberechtigung oder –erlaubnis verfügen; teilweise kann der Nachzug im Wege des Ermessens zugelassen werden. Inhaber von Aufenthaltsbewilligungen und –befugnissen haben wesentlich geringere und Asylbewerber fast keine Chancen beim Nachholen ihrer Angehörigen.
Kinder
Untersucht man auf dieser Grundlage, in welchen Fällen ausdrücklich oder in anderer Weise Integrationsvoraussetzungen verlangt werden, fällt der Blick zunächst auf die Kinder.
Werden sie in Deutschland geboren (auch dieses Ereignis fällt rechtlich unter die Begriffe „Familiennachzug“ und „Familienzusammenführung“), erwerben sie entweder die deutsche Staatsangehörigkeit oder einen Rechtsanspruch auf ein Aufenthaltsrecht. In beiden Fällen wird die Integrationserwartung allein an die bereits erfolgte Integration mindestens eines Elternteils geknüpft und diese wiederum allein aus dem Besitz eines soliden Aufenthaltstitels gefolgert. Ebenso verhält es sich bei dem minderjährigen ledigen Kind eines Asylberechtigten und dem unter 16 Jahre alten ledigen Kind eines Ausländers, dessen beide Elternteile in Deutschland leben und über eine Aufenthaltsberechtigung oder –erlaubnis verfügen. Waisen müssen und Kinder aus geschiedenen Ehen können gleichbehandelt werden. Die abgeleiteten Aufenthaltsansprüche dieser Kinder bestehen unabhängig davon, ob die Kinder bereits im Bundesgebiet leben oder erst einreisen wollen. In allen diesen Fällen darf das bloße Abstellen auf einen gesicherten Aufenthalt der Eltern nicht darüber hinwegtäuschen, dass mittelbar doch bestimmte Integrationsanzeichen zugrunde gelegt werden, nämlich die Sicherung des Unterhalts und ausreichenden Wohnraums. Der Zuziehende selbst braucht aber keine besonderen Fähigkeiten nachzuweisen, sich in die hiesigen Lebensverhältnisse einzugliedern.
{mosgoogle}
Solche persönlichen Anforderungen werden indes an andere Kinder gestellt. Ledige Minderjährige können im Ermessenswege eine Aufenthaltserlaubnis auch nach Vollendung des 16. Lebensjahres erhalten. Sie müssen aber
- entweder die deutsche Sprache beherrschen
- oder die Gewähr bieten, dass sie sich aufgrund ihrer bisherigen Ausbildung und Lebensverhältnisse in die Lebensverhältnisse in Deutschland einfügen können
- oder von einem Ausländer abstammen, der seinerseits in Deutschland geboren oder als Minderjähriger eingereist ist („2. Generation“), und dann muss der Lebensunterhalt ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel gesichert sein.
An diesen drei Varianten wird deutlich, dass der Gesetzgeber als Integrationsnachweis je nach Ausgangslage entweder Indikatoren wie die Unterhaltssicherung genügen lässt oder eine Prognose nach einer Gesamtbetrachtung aufgrund der allgemeinen Lebenssituation zugrunde legt oder aber die Deutschsprachkenntnisse als das typische Integrationsmittel heranzieht. Die Spanne der Nachweise und damit auch des Grades und der Qualität der Integration ist weit und in der Struktur kaum durchschaubar. Dabei fällt nicht einmal besonders ins Gewicht, dass von dem nachziehenden Jugendlichen die Beherrschung der deutschen Sprache verlangt wird, während für die Einbürgerung ausreichende Deutschkenntnisse ausreichen und diese in manchen Bundesländern nicht einmal Schreibfähigkeiten umfassen müssen. Für die unbefristete Aufenthaltserlaubnis eines nachgezogenen Kindes sind andere Integrationsvoraussetzungen aufgestellt. Dieser Jugendliche muss entweder bei Vollendung des 16. Lebensjahres seit acht Jahren eine Aufenthaltserlaubnis besitzen oder aber bei Erreichen der Volljährigkeit außer diesem längeren Voraufenthalt ausreichende Deutschkenntnisse und, falls er sich nicht in einer qualifizierten Ausbildung befindet, einen gesicherten Unterhalt nachweisen. Wie genau der Gesetzgeber auch diese komplizierten Unterscheidungen hinsichtlich der Integration überprüft und modifiziert, zeigt die Bestimmung, wonach auf die Dauer des Titelbesitzes in der Regel Zeiten eines Schulbesuchs im Ausland nicht angerechnet werden.
Ehegatten
Ein ähnlich buntes Bild bietet sich beim Ehegattennachzug. Hier ist der Nachzug unter den üblichen Voraussetzungen (Sicherung von Wohnraum und Unterhalt), aber ohne sonstige Anforderungen an die Integration zu Ausländern gestattet, die als Asylberechtigte anerkannt sind oder eine Aufenthaltsberechtigung besitzen. Bei Ausländern der ersten Generation (Einreise als Erwachsener) muss die Ehe schon bei der Einreise bestanden haben und beim ersten Genehmigungsantrag angegeben worden sein. Angehörige der zweiten Generation (Einreise als Minderjähriger) müssen nicht nur volljährig sein und mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland leben, sondern auch eine unbefristete Erlaubnis oder eine Berechtigung besitzen.
Beim Ehegattennachzug zu Personen mit einem solide gesicherten Daueraufenthalt sieht der Gesetzgeber also ebenso wie beim Zuzug zu Deutschen die eheliche Gemeinschaft als ausreichende Grundlage an. Er setzt damit offenbar ähnlich wie beim Kindernachzug auf die Integrationskraft des bereits hier lebenden Ausländers. Unter diesem Gesichtspunkt hält er jedoch den Minderjährigen, auch wenn dieser nach seinem Heimatrecht durch die Eheschließung volljährig werden sollte, nicht für geeignet; ahct Jahre Leben in Deutschland wird bei ihm nicht für ausreichend erachtet
{mosgoogle}
Während für die unbefristete Verlängerung der ehebezogenen Aufenthaltserlaubnis die Fähigkeit zur mündlichen Verständigung auf einfache Art in deutscher Sprache vorausgesetzt wird, fehlt es für das eigenständige Aufenthaltsrecht an solchen Erfordernissen. Für die Verselbständigung des Aufenthaltsrechts nach Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft genügt vielmehr deren Führung in Deutschland über einen Zeitraum von zwei Jahren. Im ersten Jahr nach der Trennung oder Scheidung ist sogar der Sozialhilfebezug unschädlich.
Ausblick
Diese feinen Unterscheidungen nach vielerlei Merkmalen lassen nur zum Teil den sie tragenden sachlichen Grund erkennen. Sie stützen, auch wenn sie teilweise gerechtfertigt oder jedenfalls nachvollziehbar erscheinen, jedenfalls die These, dass der Nachzug zusätzlicher Familienangehöriger grundsätzlich als Belastung angesehen wird und deswegen möglichst verhindert werden soll. Die verfassungsrechtlich gebotene Förderung von Ehe und Familie kommt dabei ebenso zu kurz wie die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die besondere Integrationskraft der Familie. Die in Deutschland in den nächsten zwei Jahren noch umzusetzenden EU-Richtlinien über die Familienzusammenführung und das Daueraufenthaltsrecht für Drittstaatsangehörige sowie das nunmehr verabschiedete Zuwanderungsgesetz, das im Januar 2005 in Kraft treten wird, lassen einen Wechsel des herrschenden Integrationsverständnisses erkennen.
{mosgoogle}
Drittstaatsangehörige sind aber danach anders als Unionsbürger grundsätzlich auf die Kernfamilie beschränkt. Für diese Begrenzung sind offenbar wie für die entsprechenden Regelungen in den Mitgliedstaaten vorwiegend Kapazitätsüberlegungen maßgeblich. Ob diese angesichts des demografischen Absinkens in Gesamteuropa künftig noch als vernünftig gelten können, ist Sache der Politik. Die Bedeutung der Sprachkenntnisse wird stärker erkannt.
Thesen
- Eine allseits verbindliche Definition für „Integration“ existiert nicht. Unter Integration wird hier zunächst, ohne weiter zu unterscheiden, die Einordnung in deutsche Lebensverhältnisse verstanden: Sie bedeutet keine Assimilierung, kann auf Teilbereiche des Lebens beschränkt sein und schließt grundsätzlich die Möglichkeit ein, dass sich auch die Aufnahmegesellschaft verändert.
- Der deutsche Gesetzgeber verfolgt keinen einheitlichen Plan für den Inhalt und das Verfahren einer Integration von Ausländern. Daher kennt er auch kein einheitliches Integrationsziel für Ausländer, die im Familienverband leben. Jede Integrationspolitik hat sich indes an den rechtlichen Vorgaben für Einreise und Aufenthalt auszurichten.
- Die Zuwanderung von Unionsbürgern beruht auf der gemeinschaftsrechtlichen Freizügigkeit, die lediglich an den Besitz der Staatsangehörigkeit eines EU-Staats anknüpft und die Integration in den Aufenthaltsmitgliedstaat dem freien Spiel der Kräfte und damit dem Zusammenwirken des wandernden Unionsbürgers und der Aufnahmegesellschaft überlässt. Dabei wird das Zusammenleben von Familienverbänden als positiver Integrationsfaktor gefördert und nicht behindert. {mosgoogle}
- Zuzug und Aufenthalt von Ausländern, die weder aus einem EU-Staat noch aus einem sonstigen EWR-Staat noch aus der Schweiz stammen, sind im geltenden deutschen Recht streng reglementiert und nur für genau bestimmte Zwecke gestattet. Zuzug und Nachzug von Familienangehörigen werden nur in engen Grenzen zugelassen. Die Voraussetzungen sind schwer zu überschauen, weil ohne erkennbares durchgängiges System akribisch differenziert. Unterschieden wird vor allem nach Aufenthaltszweck und –dauer, nach dem Grad der Verwandtschaft und bei Kindern nach dem Lebensalter. Dabei wird der zusätzliche Zuzug von Familienangehörigen grundsätzlich als Belastung angesehen. Ob er für die Integration förderlich sein könnte, wird nicht berücksichtigt. Die Wahrnehmung einer familiären Beistandsverpflichtung wird nur in engen Ausnahmefällen als Aufenthaltsgrund anerkannt.
- Das künftige Aufenthaltsrecht für Drittstaatsangehörige aufgrund des Zuwanderungsgesetzes und der noch umzusetzenden EU-Richtlinien über Daueraufenthalt und Familienzusammenführung legt einen geänderten Integrationsbegriff zugrunde. Ob sich dadurch wesentliche Veränderungen bei der Integration ausländischer Familien ergeben werden, bleibt abzuwarten.