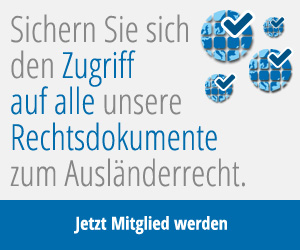Der Europäische Gerichtshof hat mit seinem Urteil vom 29. April 2010 überraschend den erstmaligen Zuzug von Arbeitnehmern und ihren Familienangehörigen als vom Anwendungsbereich der Stillhalteklausel des Art. 13 ARB 1/80 erfasst angesehen. In dem Vertragsverletzungsverfahren der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gegen das Königreich der Niederlande (Rs. C-92/07) ging es um die Gebühren für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis. Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für den Nachzug von Familienangehörigen türkischer Arbeitnehmer.
Mit ihrer Klage beantragte die Kommission u.a. festzustellen, dass die Niederlande durch die Einführung und Beibehaltung einer Regelung für die Ausstellung von Aufenthaltserlaubnissen höhere Gebühren als diejenigen vorsieht, die von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten sowie für die Ausstellung entsprechender Dokumente verlangt werden, gegen seine Verpflichtungen aus Art. 13 ARB 1/80 verstoßen hat.
Art. 13 dieses Beschlusses lautet: „Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei dürfen für Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen, deren Aufenthalt und Beschäftigung in ihrem Hoheitsgebiet ordnungsgemäß sind, keine neuen Beschränkungen der Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt einführen."
Das Königreich der Niederlande machte geltend, dass die Stillhalteklausel nicht auf die erstmalige Aufnahme von türkischen Arbeitnehmern in einem Mitgliedstaat anzuwenden sei.
Würdigung durch den Gerichtshof
Der EuGH legt zunächst dar, dass Art. 13 ARB 1/80 gerade auch die türkischen Staatsangehörigen erfasst, die noch keine Rechte in Bezug auf Beschäftigung und entsprechend auf Aufenthalt nach Art. 6 Abs. 1 dieses Beschlusses genießen. Außerdem legt er dar, dass die Stillhalteklausel in Art. 13 des Beschlusses Nr. 1/80 und diejenige in Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls gleichartig seinen und die beiden Klauseln dasselbe Ziel verfolgen.
Anschließend folgt unter Randnummer 49 die wichtige Feststellung: „ Daraus folgt, dass Art. 13 des Beschlusses Nr. 1/80 von dem Zeitpunkt an, zu dem dieser Beschluss in den Niederlanden in Kraft getreten ist, der Einführung neuer Beschränkungen der Ausübung der Arbeitnehmerfreizügigkeit in das niederländische Recht einschließlich solchen entgegensteht, die die materiell- und/oder verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die erstmalige Aufnahme türkischer Staatsangehöriger im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats betreffen, die dort von dieser Freiheit Gebrauch machen wollen.
50 Demnach gelten die Stillhalteklauseln in Art. 41 Abs. 1 des Zusatzprotokolls und Art. 13 des Beschlusses Nr. 1/80 von dem Zeitpunkt an, zu dem diese Bestimmungen in Kraft getreten sind, für alle Gebühren, die türkischen Staatsangehörigen für die Ausstellung einer Aufenthaltserlaubnis bei der erstmaligen Aufnahme im Hoheitsgebiet der Niederlanden oder für die Verlängerung einer solchen Erlaubnis auferlegt werden."
Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden:
1. Das Königreich der Niederlande hat durch die Einführung und Beibehaltung einer Regelung für die Ausstellung von Aufenthaltserlaubnissen, die Gebühren vorsieht, die im Vergleich zu den von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten für die Ausstellung entsprechender Dokumente verlangten Gebühren unverhältnismäßig sind, und durch die Anwendung dieser Regelung auf türkische Staatsangehörige, die ein Aufenthaltsrecht in den Niederlanden haben gemäß
– dem Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, das am 12. September 1963 in Ankara von der Republik Türkei einerseits und den Mitgliedstaaten der EWG und der Gemeinschaft andererseits unterzeichnet und durch den Beschluss 64/732/EWG des Rates vom 23. Dezember 1963 im Namen der Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt wurde;
– dem Zusatzprotokoll, das am 23. November 1970 in Brüssel unterzeichnet und durch die Verordnung (EWG) Nr. 2760/72 des Rates vom 19. Dezember 1972 im Namen der Gemeinschaft geschlossen, gebilligt und bestätigt wurde;
– dem Beschluss Nr. 1/80, der am 19. September 1980 vom Assoziationsrat erlassen wurde, der durch das Assoziierungsabkommen eingeführt wurde und aus Mitgliedern der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Rates der Europäischen Union und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften einerseits und Mitgliedern der türkischen Regierung andererseits zusammengesetzt ist, gegen seine Verpflichtungen aus Art. 9 des Assoziierungsabkommens, Art. 41 des Zusatzprotokolls und aus den Art. 10 Abs. 1 und 13 des Beschlusses Nr. 1/80 verstoßen.
2. Das Königreich der Niederlande trägt die Kosten. Die Bundesrepublik Deutschland trägt ihre eigenen Kosten.
Anmerkung
Die Standstill-Problematik erfordert eine Differenzierung zwischen den begünstigten Personengruppen, da sich nicht alle türkische Staatsangehörige auf Standstill-Klauseln berufen können und die einschlägigen Bestimmungen zudem unterschiedliche Voraussetzungen aufweisen. Demgemäß muss genau geprüft werden, ob und ggf. welcher der verschiedenen Standstill-Klauseln der jeweilige türkische Staatsangehörige unterfällt. Dabei macht es einen Unterschied, ob es sich um Arbeitnehmer, deren Familienangehörige, Selbständige oder Dienstleistungserbringer bzw. -empfänger handelt.
Insgesamt sind folgende Bestimmungen anzuwenden:
• Für Arbeitnehmer: Art 7 ARB 2/76.
• Für Familienangehörige der Arbeitnehmer: Art 13 ARB 1/80.
• Für Selbständige: Art 41 I Zusatzprotokoll.
• Für Dienstleistungserbringer und -empfänger: Art 41 I Zusatzprotokoll.
Bei der Anwendung der einzelnen Standstill-Klauseln sind nicht nur die unterschiedlichen Tatbestandsvoraussetzungen zu beachten, sondern auch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass sie zu unterschiedlichen Zeiten wirksam geworden sind. Dabei gilt für die Anwendbarkeit:
• Das Zusatzprotokoll vom 23.11.1970 ist am 1.1.1973 in Kraft getreten.
• Der ARB 1/80 vom 19.9.1980 ist am 1.7.1980 in Kraft getreten. Nach Art 16 ARB 1/80 ist aber Art 13 ARB 1/80 erst ab dem 1.12.1980 anwendbar.
• Der ARB 2/76 vom 20.12.1976 ist am 1.12.1976 in Kraft getreten.
Für Arbeitnehmer ist unmittelbar Art 7 ARB 2/76 und nicht erst Art 13 ARB 1/80 anwendbar. Denn diese Bestimmung enthielt eine Standstill-Klausel, deren Wortlaut sich nur dadurch von Art 13 ARB 1/80 unterscheidet, dass sie ausschließlich Arbeitnehmer und nicht auch deren Familienangehörige begünstigt. Erst durch Art 13 ARB 1/80 wurde nach „Arbeitnehmer" zusätzlich die Worte „und ihre Familienangehörige" aufgenommen. Damit stärkt der ARB 1/80 die Rechtsstellung der Familienangehörigen, was auch beabsichtigt war, wie seiner Vorbemerkung entnommen werden kann: „Im sozialen Bereich führen die vorstehenden Erwägungen im Rahmen der internationalen Verpflichtungen jeder der beiden Parteien zu einer besseren Regelung zugunsten der Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen gegenüber der mit Beschluss Nr. 2/76 des Assoziationsrats eingeführten Regelung."
Die Standstill-Klausel des Art 7 ARB 2/76 findet neben Art 13 ARB 1/80 Anwendung, so dass alle seither eingetretenen aufenthalts- und arbeitsmarktrechtlichen Beschränkungen auf türkische Arbeitnehmer nicht erst seit dem 1.12.1980, sondern bereits seit dem 1.12.1976, dh dem Inkrafttreten des ARB 2/76, unanwendbar sind. Nach Auffassung des EuGH ist der ARB 2/76 zwar grundsätzlich unanwendbar, da der ARB 1/80 für die türkischen Arbeitnehmer und ihre Familienangehörigen günstigere Regelungen enthält. Dieser Vorrang des ARB 1/80 vermag aber nicht für die Standstill-Klausel des Art 7 ARB 2/76 zu gelten, denn andernfalls würde der Rechtsstatus der Arbeitnehmer in zeitlicher Hinsicht verschlechtert, weil alle negativen aufenthalts- und arbeitsrechtlichen Veränderungen bis zum Inkrafttreten des ARB 1/80 am 1.12.1980 plötzlich wirksam geworden wären . Ein dahin gehender Wille des Assoziationsrates kann dem ARB 1/80 nicht entnommen werden; vielmehr sollte auch die Rechtsstellung der Arbeitnehmer verbessert werden.
Nach Art 13 ARB 1/80 dürfen die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei „für Arbeitnehmer und ihre Familienangehörige, deren Aufenthalt und Beschäftigung in ihrem Hoheitsgebiet ordnungsgemäß sind, keine neue Beschränkungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt einführen." Die Vorschrift, die rechtlich eine reine Unterlassungspflicht beinhaltet, verleiht nicht unmittelbar ein Aufenthaltsrecht, sondern verwehrt den Vertragsparteien, die innerstaatlichen Regelungen für die Begünstigten gegenüber dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Klausel zu erschweren. Nicht erfasst werden daher Beschränkungen, die eine Vertragspartei bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Standstill-Klausel erlassen hatte; deren Beibehaltung, auch in veränderter Form, ist daher grundsätzlich unschädlich.
Begünstigt werden türkische Staatsangehörige, deren Aufenthalt und Beschäftigung ordnungsgemäß sein müssen. Das Tatbestandsmerkmal „ordnungsgemäß" bezieht sich ausdrücklich auch auf den Aufenthaltsstatus und nicht nur – wie Art 6 ARB 1/80 – auf die Ausübung einer Beschäftigung. Das Merkmal ordnungsgemäß stellt damit sicher, dass die türkischen Staatsangehörigen sich im Einklang mit den nationalen Bestimmungen im Bundesgebiet aufhalten müssen, so dass weder aus einem illegalen Aufenthalt noch einer unrechtmäßigen Beschäftigung rechtliche Vorteile abgeleitet werden können.
Indem die Standstill-Klausel daran anknüpft, dass der Aufenthalt in dem Hoheitsgebiet der Vertragspartei ordnungsgemäß sein muss, wird an sich – wie das Königreich der Niederlande im Vertragsverletzungsverfahren vorgetragen hatte – vorausgesetzt, dass nur Personen erfasst werden, denen der Zuzug in das Bundesgebiet gestattet wurde. Würde die Standstill-Klausel aber erst zur Anwendung, wenn dem türkischen Staatsangehörigen die Einreise in das Bundesgebiet nach den nationalen bzw. supranationalen Bestimmungen gestattet worden war, so würden die Einreisebestimmungen selbst – jedenfalls für den erstmaligen Zuzug – nicht von der Standstill-Klausel erfasst.
Dieser Auslegung hat nunmehr der EuGH – entgegen dem klaren Wortlaut des Art. 13 ARB 1/80 – widersprochen und damit auch den erstmaligen Zuzug von Arbeitnehmern und ihren Familienangehörigen als vom Anwendungsbereich der Stillhalteklausel erfasst angesehen. Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Frage der Gebührenhöhe, sondern strahlt auch in den Bereich der sonstigen Zuzugsverschärfungen aus. So stellt sich die Frage, ob auch die Sprachanforderungen gegenüber türkischen Familienangehörigen aufrechterhalten werden dürfen, wenn die die materiellrechtlichen Voraussetzungen für die erstmalige Aufnahme türkischer Staatsangehöriger von Art. 13 ARB 1/80 erfasst werden.
Führt man die Rechtsprechung des EuGH konsequent weiter, so kann dies nur dazu führen, dass die Nachzugsvoraussetzungen gegenüber Ehegatten, die sich auf die Stillhalteklausel des Art. 13 ARB 1/80 berufen können, weil sich ihr Ehepartner im Bundesgebiet als Arbeitnehmer aufhält, nicht gegenüber dem Rechtszustand am 1. Dezember 1980 verschärft werden dürfen. Damit sind Sprachanforderungen für den Ehegattennachzug unvereinbar!