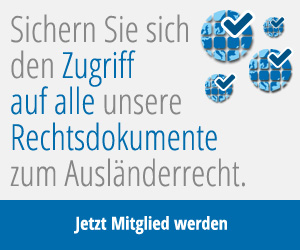Rücknahme gerichtlich bestätigter Ausweisungen von Unionsbürgern
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am 22. Oktober 2009 (1 C 18.08 und 1 C 26.08) entschieden, unter welchen Voraussetzungen ein Ausländer gegenüber der Verwaltung die Rücknahme einer Ausweisung verlangen kann, wenn diese ohne Erfolg gerichtlich angefochten worden war, sich nach Änderung der Rechtsprechung inzwischen aber als rechtswidrig erweist.
Die Entscheidungen betreffen einen italienischen und einen türkischen Staatsangehörigen. Beide Kläger sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie wurden 1997 bzw. 2002 ausgewiesen, nachdem sie wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu Freiheitsstrafen verurteilt worden waren. Die gegen die Ausweisungen erhobenen Klagen wurden vom Verwaltungsgericht rechtskräftig abgewiesen. Nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Umsetzung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) im August 2004 die Anforderungen an die Ausweisung freizügigkeitsberechtigter EU-Bürger und assoziationsberechtigter türkischer Staatsangehöriger verschärft hatte, beantragten die Kläger die Rücknahme der gegen sie verfügten Ausweisungen. Diese seien bei Zugrundelegung der neuen Maßstäbe rechtswidrig. Die Anträge wurden von der Ausländerbehörde abgelehnt. Die hiergegen erhobenen Klagen hatten vor dem Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg keinen Erfolg. Die Wirkungen der Ausweisungen wurden inzwischen in beiden Fällen befristet, so dass für die Kläger das mit der Ausweisung verbundene Einreise- und Aufenthaltsverbot nicht mehr besteht.
Der 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts ist in beiden Verfahren den Entscheidungen der Vorinstanzen gefolgt. Bei der Rücknahme einer gerichtlich bestätigten Ausweisung ist § 121 VwGO zu beachten. Diese Vorschrift löst den Konflikt zwischen Rechtssicherheit und Rechtsfrieden einerseits und materieller Gerechtigkeit andererseits dahin, dass ein rechtskräftiges Urteil ungeachtet der materiellen Rechtslage für die Beteiligten bindend ist. Diese Bindung kann nur auf gesetzlicher Grundlage überwunden werden. So wenn der Betroffene einen Rechtsanspruch auf ein Wiederaufgreifen des Verfahrens hat oder die Behörde das Verfahren im Ermessenswege wieder aufgreift. Die Klärung einer gemeinschaftsrechtlichen Frage durch den EuGH und eine Änderung der höchstrichterlichen Rechtsprechung stellen von Rechts wegen keinen zwingenden Wiederaufnahmegrund nach dem hier maßgeblichen Verwaltungsverfahrensgesetz dar. Die Behörde war auch nicht verpflichtet, die Verfahren nach Ermessen wieder aufzugreifen. Zwar kann sich dieses Ermessen zu Gunsten des Betroffenen im Ausnahmefall zu einem Anspruch verdichten. Dies beispielsweise, wenn die Aufrechterhaltung der Ausweisung wegen offensichtlicher Fehlerhaftigkeit schlechthin unerträglich oder wenn die Überprüfung des Verwaltungsaktes aus Gründen des europäischen Gemeinschaftsrechts geboten ist. Beides lag hier nicht vor. Die Ausländerbehörde hatte es in beiden Verfahren ermessensfehlerfrei abgelehnt, das Verfahren wieder aufzugreifen, so dass die Revisionen erfolglos blieben.
Quelle: Presseerklärung des Bundesverwaltungsgerichts